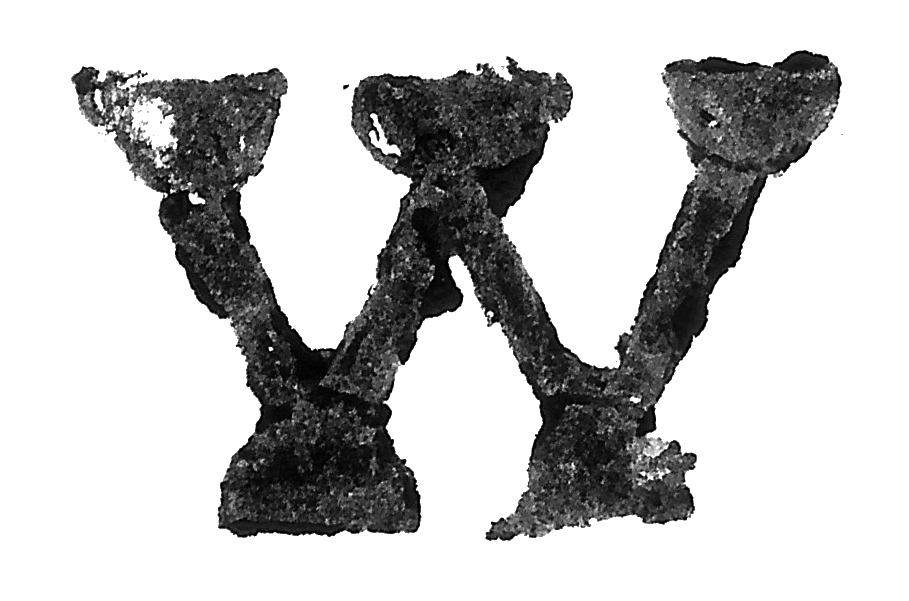Bin ich hier richtig? Warum es ok ist, zweifelnd zu demonstrieren.
Frisch radikalisiert durch Übergriffe auf Ausländer*innen und People of Color in Deutschland entschließe ich, meinen Körper öfter auf Demonstrationen gegen Rassismus zu platzieren.
Schließlich habe ich keine Ausrede – da selbständig, kann ich mir die Zeit nehmen, da körperlich gesund, kann ich hin, und die aktuelle Lage zeigt mir überzeigend, dass Handlung angesagt ist. Gut, das mit der Hochsensibilität und der Panik vor Menschenmengen – aber scheiß drauf: Ich war bereit und fest entschlossen, auf jede Demo gegen Fremdenhass und Rassismus in meinem Umkreis zu gehen, und da ich in Leipzig wohne, gibt der Umkreis auch was her.
Dann kamen die Zweifel.
Der erste Versuch in Chemnitz lief gut, also Zug nach Berlin gebucht, Verabredungen getroffen – und dann die Nachricht von Wagenknecht, dass sie nicht hingeht, dass ihre Sammelbewegung „Aufstehen“ die #unteilbar-Demo nicht unterstütze. Was mich in's Schlingern brachte.
Nicht, weil Sahra Wagenknecht immer Recht hätte, aber weil sie hier einen wichtigen Punkt getroffen hat:
„Der Unteilbar-Aufruf hat aber das Problem, dass weder die Verantwortlichen für Fluchtursachen noch für den massiven Sozialabbau der letzten Jahre benannt werden. Damit fehlt dem Protest aber die wichtige Adressierung der politischen Verantwortung für die gravierenden Missstände.“
Es hätte auch für mich in dem Aufruf noch viel klarer benannt werden müssen, wer die Verantwortlichen daran sind, dass es sich in den Herkunftsländern der Geflohenen nicht mehr menschenwürdig leben lässt (Überraschung: wir! Weil wir die großen Konzerne und Lobbyisten ungestraft in Ruhe mauscheln lassen, weil wir ungehemmt konsumieren, weil wir immer noch meinen, dauernd auf irgendwelche Inseln in den Urlaub fliegen zu müssen) und was sich verändern muss (Zum Beispiel die Waffenexporte sofort einstellen, sofort und dauerhaft den Klimawandel wirklich ernst nehmen, einen Hauch von Dankbarkeit entwickeln für das Schlaraffenland, in dem wir leben und von dem die meisten von uns profitieren).
Das trifft mich in meinem Zweifeln, was eine Demonstration überhaupt leisten kann: Erwarte ich mir davon eine Antwort der Politik, vielleicht sogar einen Politikwechsel? Erhoffe ich mir, dass ich eine schwankende unentschlossene Masse davon überzeugen kann, dass es auf der linken Seite schöner ist als rechts? Will ich damit den Rechtsextremen Angst machen, indem wir zeigen, dass wir viele gegen sie sind?
Sieht so eine deutsche Vulva aus?
Das mit der Regulierung.
„Es gibt auch viele Menschen, die sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wehren wollen und zugleich eine Regulierung der Migration für unerlässlich halten. In einer sachbezogenen und demokratischen Auseinandersetzung muss auch dieser Standpunkt respektiert werden.“
Das war der zweite Teil von Sahra Wagenknechts Aussage, und der hat mich dann wieder hin zu #unteilbar getrieben.
Ich will mich auf jeden Fall wehren gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Und ich vermute auch, dass ein komplett unstrukturiertes Aufnehmen von Migrant*innen in unserer heutigen Gesellschaft nicht funktionieren wird – nicht, wenn wir weiterhin die Integration dieser Menschen so gut wie gänzlich Ehrenamtlichen überlassen, nicht, wenn wir weiterhin ihre Heimat zerstören und ihnen unser ausschweifend konsumorientiertes Leben vorführen, nicht, wenn wir gleichzeitig die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland ignorieren.
So weit könnte ich also in der Theorie noch dem zweiten Teil der Wagenknecht’schen Aussage zustimmen. Und trotzdem geht er für mich gar nicht: Die Formulierung „Regulierung der Migration“ ist in diesem Kontext zu glitschig-gefährlich und zu stark besetzt, als dass ich sie so unterschreiben könnte. Vor allem, wenn Alexander Gauland sie gleich bejubelt.
Also auf allen Seiten halb dabei?
Ich frage mich immer mehr, wofür genau „Aufstehen“ stehen will und steht. Eine Sammlungsbewegung für den Frieden, die es nicht schafft, die größte Solidaritäts-Demo in ganz Deutschland zu unterstützen? Die sich nicht stark oder präsent genug fühlt, um auf der Vielfalt dieser Demo ihre eigenen Positionen zu platzieren? Das macht mir keine große Lust, mich dort hin zu sammeln.
Je mehr ich mich mit dem Thema befasse, umso klarer wird mir, dass diese Aussagen vermutlich gar nicht so viel mit der Demo zu tun haben, sondern einfach ein weiterer Schauplatz der internen Differenzen der Linkspartei sind. Die mich nur halb was angehen und mit meiner Teilnahme an einer Demo eigentlich gar nichts zu tun haben.
Trotzdem haben sie mich kurz beinah davon abgehalten, teilzunehmen, und das finde ich gefährlich und unverantwortlich.
Die Identifizierungsfalle
Es kostet mich Überwindung, überhaupt bei einer Demo mitzulaufen oder mich einer Organisation anzuschließen: Ich bin Kind meiner Zeit.
Ich bin es gewohnt, alles für mich bis ins letzte Detail auszuformulieren, alles so anzupassen, bis es 100% zu mir passt, bis ich komplett dahinter stehen kann. Ich kann mein gesamtes Leben, vom Instagram-Feed bis zum Turnschuh, in Ruhe so individualisieren, dass ich mich damit identifizieren kann. Dank meiner Selbständigkeit kann ich jeden Tag nur das tun und das von mir geben, von dem ich komplett überzeugt bin. Ich bin, außer in dieser Redaktion, in keinen Gruppen oder Organisationen Mitglied. Ich muss mich selten abstimmen, muss kaum üben, außerhalb von Zweierbeziehungen Kompromisse zu schließen, die die Grundimpulse und -bedürfnisse aller beinhalten.
Dass ich mich in eine Masse von 242.000 Menschen stelle und behaupte, das Gleiche zu wollen wie sie, ist dann auf einmal ganz schön viel von mir verlangt.
Und wie großartig, dann langsam zu begreifen und in mich hineinsickern zu lassen, dass das niemals das Gleiche sein kann und es auch nicht muss.
Dass das ein normaler politischer Protest ist, dass das immer so ist, dass wir alle, die wir da auf der Straße stehen, unglaublich unterschiedlich sind und uns trotzdem an ein paar Punkten einig sind.
Auch wenn es „nur“ der Punkt ist, dass wir alle miteinander verhindern wollen, dass sich in Deutschland Geschichte wiederholt (und dass diese Geschichte weder kleingeredet noch vergessen werden darf). Auch wenn wir uns über das Wie und die Maßnahmen und nächsten Schritte uneinig sind, ist das trotzdem okay und stark genug und wichtig genug, dass wir gemeinsam und geschlossen auf die Straße gehen.
Eine unübersehbare Vielfalt von Positionen bei der #unteilbar-Demo am 13. Oktober 2018 in Berlin.
Unteilbar heißt nicht einer Meinung.
„Zu den Widersprüchen gehört auch, dass Regierungsparteien mitmarschiert sind, deren Politik viele der DemonstrantInnen auf die Straße getrieben hat und die sich teils die Agenda der Rechten aufzwingen lassen. Trotzdem kommt ohne sie nicht aus, wer die RechtspopulistInnen stoppen will.“
Schreibt Christian Jakob in seinem Kommentar zur Unteilbar-Demo.
Wie wichtig dieses Überwinden ist! Und was für ein geiles Zeichen, dass wir als Generation der Individualisten das offensichtlich in so großem Stil hinbekommen. Trotz prominenter linker Politikerinnen, die sich nicht überwinden konnten.
Lieber „freiheitlich“ statt „links“.
Antje Schrupp denkt das hier ganz wunderbar weiter, in einer Überlegung, die für mich ein befreiender Paukenschlag ist, der mich aus meinem „Wo gehöre ich hin“ Schlingern herausholt:
„Die relevante politische Unterscheidung wäre dann nicht „links“ und „rechts“, sondern vielleicht „freiheitlich“ und „repressiv“: Es gibt eine freiheitliche Art, Apfelkuchen zu backen, und eine repressive. Es gibt eine freiheitliche Art der Globalisierung und eine repressive. Es gibt eine freiheitliche Art der Wertschätzung regionaler und lokaler Eigenheiten und eine repressive. Es gibt eine freiheitliche Art, über patriarchale Denkmuster zu diskutieren und dabei ausdrücklich in Bezug auf kulturelle und religiöse Hintergründe zu nehmen, und eine rassistische. Und so weiter und so fort.
Der Unterschied ist gewissermaßen qualitativ groß, aber quantitativ klein.
(…)
„Rechte“ wären nicht unbedingt welche, die ganz weit weg am anderen Ende einer langen Skala leben, sondern sie sind nebenan. Eventuelle Gemeinsamkeiten, die ich zwischen mir und meiner „rechten“ Nachbarin bemerke, müssen mich nicht gleich in Panik versetzen, weil sie nicht unbedingt ein Zeichen dafür sind, dass ich auch schon fast rechts bin. Im Gegenteil, sie können mir vielleicht dabei helfen, mit ihr ins Gespräch zu kommen und ihr die Tür (oder das Wurmloch) zurück „zu uns“ zu zeigen. Denn es ist kein weiter Weg.“
Politischer Perfektionismus hilft niemandem weiter.
Unter freiheitlich in diesem Sinn kann ich mich jederzeit versammeln.
Es stimmt, was Alexander Ulrich laut taz über Sahra Wagenknecht schrieb: „Ist es so schwer, einmal das Verbindende zu suchen?“. Warum kann sie nicht so selbstbewusst sein, dass sie (wie alle anderen auch) ihre eigenen Themen und Standpunkte mitbringt und trotzdem den grundsätzlichen Impuls, den sie ja angeblich auch mitträgt, mittragen?
Das wollte ich, und das habe ich gemacht.
Innerlich habe ich dabei auch in die Kameras gerufen: Ich bin nicht liiiinks, zumindest nicht so oder so oder so! Denn ja, es liefen sicherlich bei der knappen Viertelmillion auch eine Menge von Menschen mit, deren Meinungen ich im Einzelnen nicht teile. Aber ich teile andere Bedürfnisse mit ihnen.
Ich stelle mich, allen Zweifeln zum Trotz, hin für den Individualismus anderer.
Mein eigener Individualismus, meine persönliche Freiheit, wird überhaupt erst dadurch ermöglicht, dass ich in einem (weitestgehend) sozialen und demokratischen System lebe. Eine Demonstration, die zeigt, dass sich Menschen gegenseitig ihre Andersartigkeit, ihren Individualismus, anerkennen können und gleichzeitig gemeinsam dafür kämpfen, dass diese Freiheiten erhalten bleiben, ist eine, auf der ich dabei sein will.
Klar wünsche ich mir, dass ich eine Demo finde, wo genau meine Forderungen exakt so abgebildet werden, in präzise der Sprache, die ich für richtig halte. Aber hüstel, hüstel: Dann müsste ich die vermutlich selber organisieren. Solange ich das nicht tue, schließe ich mich denen an, die sich im Großen und Ganzen mit meinen Ideen decken.
Denn es ist kein weiter Weg.
Diese Frage gehört dann allerdings auch dazu: Bin ich bereit, diejenigen, die in Chemnitz mitmarschiert sind, nicht automatisch als „rechtsradikal“ einzustufen? Dass ich ihnen eigene Forderungen anerkenne, die nicht automatisch verfassungsfeindlicher Natur sind?
Das fällt mir endlos schwer, weil der Gesamtimpuls dort so eindeutig repressiv war (wie der Gesamtimpuls von #unteilbar für mich eben eindeutig im Schruppschen Sinn „freiheitlich“ war), aber wenn es hilft, dass diese Mitläufer*innen sich besser gesehen fühlen und damit gesprächsbereiter werden, und sich damit eine Chance ergibt, sie zu erwischen, bevor sie komplett an den rechten Rand driften – dann wäre ich auch dazu bereit.
Ergänzung | 21.10.18
Im Gespräch mit Leser*innen zu diesem Artikel, unter anderem mit Wepsert-Redakteurin Alisha Gamisch, tauchten einige Fragen und Anmerkungen speziell zu diesem letzten Absatz auf, also zu der Frage, wie wir mit „Rechten“ überhaupt reden können.
Besonders wichtig fand ich dabei Alishas Anmerkung, dass ich als weiße Deutsche diese Art von Gesprächen vermutlich deutlich leichter führen kann als eine Person of Color, die direkt von Rassismus betroffen ist. Was für mich wieder ein Fall ist, wo ein Privileg und eine Freiheit vor allem auch eine Verantwortung mit sich bringt.
Was uns wiederum auf die Idee brachte, dieses riesige Thema des Redens mit Andersdenkenden – und in dem Zusammenhang auch das Verwenden von politisch „besetzten“ Begriffen, wie der von Antje Schrupp verwendete Begriff „freiheitlich“ – als eigene Serie hier auf Wepsert zu betrachten, denn das bietet Stoff für mehr als genug Artikel … Das also als Hinweis, dass wir sehr genau sehen, wie kritisch diese Themen sind und dass wir uns angemessen mit ihnen beschäftigen wollen.
Fotos von Justina Klimczyk ♥