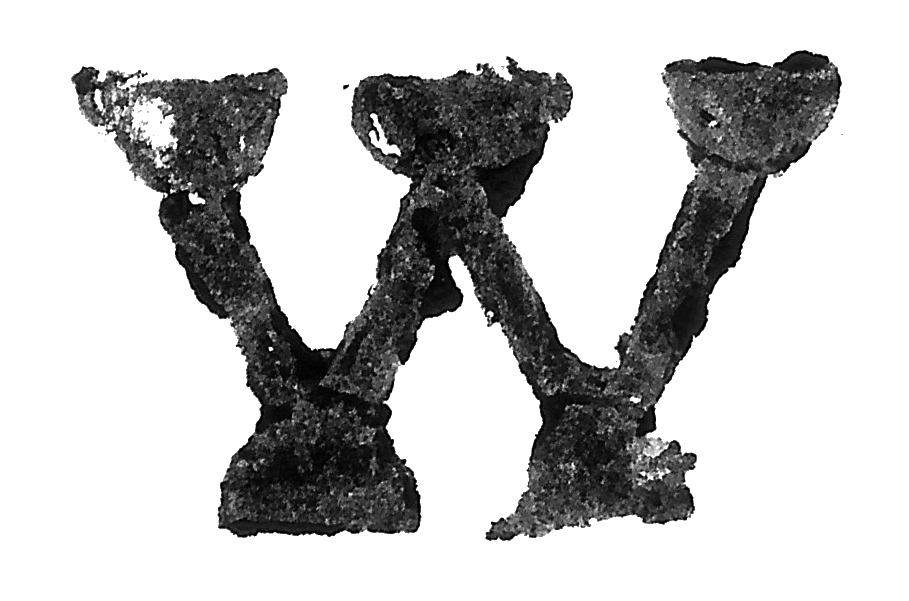Sollten wir keine Bücher von weißen Cis-Männern mehr lesen? Interview mit Arpana Berndt
In unserem Gespräch mit Sabine Scholl haben wir begonnen, uns mit dem Thema Identity Politics und Literatur zu beschäftigen. Hier kommt nun das zweite Gespräch und zwar mit der großartigen Arpana Berndt.
Du bist selbst Autorin und warst lange Redakteurin bei der BELLA triste in Hildesheim. Kannst du erzählen, wie und warum du Teil der Redaktion wurdest?
Arpana Berndt. ©cv.studio.berlin
Ich habe Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert. Die Texte, die wir in Seminaren und Werkstätten verhandelt haben, die Literaturlisten der Vorlesungen waren hauptsächlich von Weißen, mehrheitlich weißen Männern geschrieben, bildeten aber den Maßstab zur Bewertung aller Texte. Das heißt, mit dem Wissen aus Texten von weißen Autor*innen wurde dann in Textwerkstätten auch auf meine Texte geschaut.
Ich habe die Arbeit in der BELLA triste als Möglichkeit gesehen, Literatur zu veröffentlichen, die mich interessiert und Perspektiven zu lesen, in denen ich mich auch mal wiederfinde. Das sind erstmal nicht-weiße und queere Perspektiven. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich in allen Texten von nicht-weißen Autor*innen wiederfinden kann, schließlich sind unser aller Perspektiven unterschiedlich.
Doch das ist ja genau das Ding: Je mehr Geschichten wir aus unterschiedlichen Perspektiven lesen, desto differenzierter wird unser Bild.
Dafür heißt es diejenigen zu fördern, die nicht so oft gelesen werden. Sonst bleiben weiterhin nur Texte weißer Autor*innen Teil des Kanons.
Und wie ich Redaktionsmitglied wurde? Es gab eine öffentliche Ausschreibung für das Ressort der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, im Bewerbungsgespräch habe ich dann erzählt, worauf ich meinen Fokus lege. So eine öffentliche Ausschreibung war wichtig, weil ich sonst keinen Zugang zu der Arbeit in der Redaktion gefunden hätte. Als ich dann angefangen habe zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass ich ein Wissen mitbringe, dass wichtig sein könnte in der Redaktionsarbeit – gerade weil die BELLA triste ihre eigene Arbeit in aktuellen gesellschaftlichen Diskursen kritisch reflektiert.
Habt ihr bei den Auswahlprozessen für die Beitrage in der BELLA triste ausschließlich nach Text ausgewählt oder auch die jeweiligen Biographien und sozialen Hintergünde der Bewerber*innen mit berücksichtigt, so wie es die PS (Politisch Schreiben - eine Literaturzeitschrift aus Leipzig) macht?
Wir haben immer die Texte ausgewählt, die wir am besten fanden. Das geht einher mit einer Berücksichtigung von Biographien. Die BELLA triste versteht sich als Plattform für Prosa, Dramen, Drehbücher, Essays und Lyrik und auch Bilder, die etwas Neues bieten, die etwas zeigen, was noch nicht so oft gezeigt wurde, die neue Perspektiven beleuchten. Ich möchte ja keinen Text veröffentlichen, den ich so ähnlich schon mehrmals gelesen habe und da spielen Perspektiven und Hintergründe eine Rolle.
Da ist aber wieder die Frage: Nach welchen Maßstäben beurteilen wir die Texte? Ich erinnere mich an eine Diskussion um einen Text, den ein Teil der Redaktion als kitschig, klischeehaft und zu blumig wahrnahm. Ich konnte mich aber in der Dramatik der Erzählung wiederfinden, die das Leben in der Diaspora so beleuchtete, wie ich es auch aus migrantischen Familien kenne und fand die Beschreibungen unglaublich treffend und sehr real.
Also ist die Frage wichtig, wie wir Texte beurteilen können, die Milieus beschreiben, in die wir keine Einblicke haben.
Da ist wieder die Biographie der schreibenden Person wichtig, denn wenn Autor*innen nah an ihrem eigenen Erleben schreiben, finden weniger Fremdzuschreibungen statt – und mit Stereotypen, die einen selbst betreffen, können schreibende Personen bewusst umgehen. Mein Fokus lag eigentlich immer darauf, gezielt Menschen für Textbeiträge anzufragen, deren Arbeiten ich aus anderen Kontexten spannend fand und Menschen zu ermutigen, erst mal einen Text einzureichen. Je mehr Texte von unterschiedlichen Menschen wir in die Auswahlgespräche nehmen, desto interessanter werden diese Gespräche auch.
Was gefällt dir an der Arbeit im Literaturbereich? Welche Probleme siehst du beziehungsweise hast du erfahren?
Ich weiß, dass es ganz viele Geschichten gibt, die noch nicht erzählt wurden. Das müssen ungreifbar viele Geschichten sein, und ich mag die Vorstellung, dass es die Möglichkeit gibt, sie öffentlich zu erzählen.
Diese Geschichten beeinflussen unser gesellschaftspolitisches Denken. Mit jeder Geschichte bekommen wir ein differenzierteres Bild von der Welt – wenn es eben nicht die immer gleiche Geschichten sind, sondern Erzählungen, die es wagen anders zu sein.
Aber genau da sehe ich auch eine Schwierigkeit, weil ich da selber drin stecke: Ich schreibe auf Deutsch, also erst mal für ein deutschsprachiges Publikum. Ich erzähle Figuren, die nicht-weiß sind, möchte, dass sich andere Personen of Color da wieder finden.
Wie schreibe ich Texte, in denen ich nicht zu viel für weiße Leser*innen erkläre, sie aber gleichzeitig der Geschichte folgen können sollen?
Da habe ich dann ein Problem in Textwerkstätten, wenn hauptsächlich weiße Menschen in diesen Werkstätten sind und meinen Text verstehen wollen. Ich habe dann immer die Befürchtung, meinen Text zu sehr an ein weißes Publikum anzupassen. Eine weitere Frage ist, nach welchen Kriterien Texte für Stipendien und Preise besprochen und ausgewählt werden.
Wie schätzt du die gegenwärtige Lage des literarischen Betriebes in Deutschland ein, was „Identitätspolitik“ betrifft, also wer gelesen und veröffentlicht wird?
Ich denke nicht, dass ich in der Lage bin, den gesamten deutschsprachigen Literaturbetrieb zu überblicken. Ich sehe aber, dass sich viel tut, dass Romane, Essays und Sachbücher von Autor*innen of Color auch mal in höheren Auflagen verkauft werden und Preise erhalten. Natürlich habe ich auch einen Fokus auf genau diese Veröffentlichungen. Gleichzeitig finde ich, dass die Biografien der Autor*innen oft dann eine Wichtigkeit bekommen, wenn es für die eigentliche Arbeit gar nicht relevant, sondern für den Verkauf förderlich ist.
Eine Frau of Color kann einen großartigen Science-Fiction-Roman schreiben, ohne dass ihre Herkunft oder Geschlecht betont werden oder explizit im Roman hervorgehoben werden muss.
Das führt dazu, dass Arbeiten weiterhin in diesen Schubladen „Frauenliteratur“ und „Migrationsliteratur“ verhandelt werden und nicht neben allen anderen Werken stehen, die es schon gab.
Warum ist das so und was können wir tun, um den Betrieb inklusiver zu machen?
Es klingt nun erst mal widersprüchlich: Ich spreche davon, dass mehr Autor*innen of Color und Schwarze Autor*innen gefördert und veröffentlicht werden sollten, gleichzeitig sehe ich in der ständigen Betonung ihrer Identität die Gefahr, dass ihre Arbeiten in Schubladen gedacht werden und dann auch nur in diesen bewertet werden. Es ist aber gar nicht widersprüchlich, denn es geht erst mal darum, dass nicht-weiße Menschen einen Zugang zum Literaturbetrieb bekommen und in diesem ernst genommen werden, unabhängig von ihrer Identität.
Um aber über Diskriminierung im Literaturbetrieb sprechen zu können, wozu ein erschwerter Zugang gehört, braucht es dieses Sichtbarmachen vorhandener Strukturen. In Verlagen, Agenturen und Redaktionen sollten viel mehr Menschen of Color und Schwarze Menschen vertreten sein. Diese werden im Literaturbetrieb aber Rassismus erleben, müssen also mit dieser Diskriminierung in einem mehrheitlich weißen Umfeld umgehen und gleichzeitig wie alle anderen auch ihrer Arbeit nachgehen.
Die Frage ist nun, was tut der Literaturbetrieb – die einzelnen Institutionen, die Arbeitgeber*innen – dafür, dass Rassismen abgebaut werden und diejenigen, die im Betrieb negativ von Rassismus betroffen sind, geschützt werden und ihrer Arbeit nachgehen können?
Es braucht ein größeres Bewusstsein für verschiedene Diskriminierungsformen und Machtgefälle, sodass zum Beispiel Agenturen darauf achten, dass Frauen und nicht-binäre Schreibende genauso hohe Honorare bekommen wie cis-Männer, und Autor*innen of Color und Schwarze Autor*innen nicht schlechter bezahlt werden als weiße Autor*innen.
Es braucht aber auch Strukturen, die Betroffenen mehr Sicherheit bieten, wie z.B. die Anti-Rassismusklausel, die jetzt an verschiedenen Theatern besprochen wurde. Wir haben die Vereinssatzung der BELLA triste nach Vorbild der Anti-Rassismusklausel geändert. In der Satzung steht nun, dass, wenn ein Redaktionsmitglied of Color, Schwarze Redaktionsmitglieder oder anderweitig an der Entstehung der Zeitschrift beteiligte nicht-weiße Person (z.B. Autor*innen, Illustrator*innen, Fotograf*innen) in der Zusammenarbeit mit der BELLA triste Rassismus erfahren, sich alle weißen Redaktionsmitglieder dazu verpflichten, an einer Weiterbildung, die das Problem thematisiert, teilzunehmen.
Diese Klausel sorgt nicht dafür, dass es Rassismus nicht mehr gibt, aber dafür, dass diejenigen, die negativ von Rassismus betroffen sind, keine zusätzliche Erklärungsarbeit leisten müssen – und dass bei ihnen die Deutungshoheit liegt, was eigentlich Rassismus ist.
Es zeigt auch, dass der Verein Rassismus als Problem anerkennt und bereit ist daran zu arbeiten.
Der Autor Tillmann Severin schreibt in seiner Kolumne bei fixpoetry darüber, dass er keine weißen cis Männer mehr liest, weil er irgendwann gemerkt hat, dass sein Bücherregal hauptsächlich mit Büchern von diesen männlichen weißen Autoren bestückt ist. Sollten wir deiner Meinung nach alle für eine Weile keine weißen cis Dudes mehr lesen/veröffentlichen?
Ich folge auf Instagram dem Account southasianreads, einer Person, die nur black & brown authors liest und auf Instagram Empfehlungen und Rezensionen über Bücher von südasiatischen Autor*innen und Autor*innen aus der südasiatischen Diaspora zusammen stellt. Sie schreibt: it’s not that great English works by authors of color dont’t exist, it’s just that we don’t always know about them – großartige Arbeiten, die also viel zu wenig in unserem Bewusstsein sind. Das liegt auch daran, dass weißen cis-männlichen Autoren eine größere Wichtigkeit zugeschrieben wird, sie viel mehr öffentlich besprochen und gefördert werden.
Es geht also darum, unseren Blick auf diejenigen zu richten, die dabei wegfallen und uns auch zu fragen, warum zum Beispiel viel zu wenige Arbeiten südasiatischer Autor*innen ins Deutsche übersetzt werden. Ich werde keinen Einzelpersonen sagen, ob und was sie lesen müssen, das darf jede Person für sich entscheiden.
Ich frage mich aber, wie Menschen damit zufrieden sein können, immer aus den gleichen Perspektiven zu lesen und sich selbst dabei so einzuschränken.
Ich finde, dass in Deutschland viel mehr Bücher von Menschen veröffentlicht und gefördert werden sollten, die nicht-weiß und nicht cis-männlich sind. Also statt weiße cis-Männer, die Jahrhunderte alte Stereotype und Denkmuster wiederkäuen, einfach diejenigen fördern, die mit ihren Geschichten diesen schon lange widersprechen.
Du bietest auch Workshops zu Antirassismus und Themen wie Allyship an. Auch in der Literatur wird es ja oft kritisiert, wenn privilegiertere Autor*innen plötzlich über in bestimmten Feldern weniger privilegierte Menschen schreiben und dabei Diskriminierung und Rassismen bzw. Sexismen reproduzieren.
Glaubst du, dass wir vor allem über Menschen schreiben sollten, die unserer eigenen Positionierung ähnlich sind (also z.B. weiße hetero Frauen vor allem über weiße hetero Frauen etc.) ?
Das Problem ist, wenn Schreibende in privilegierten Positionen – sagen wir weiße cis-Männer – über Themen sprechen, die sie nicht betreffen, und so Fremdzuschreibungen machen, werden ihre Texte selten hinsichtlich ihrer Positionierung reflektiert und besprochen. Die Texte von Menschen, die nicht in diese Kategorien fallen, werden dagegen oft im Zusammenhang mit ihren Biographien besprochen, diese werden sogar noch extra hervorgehoben.
Weiße cis-Männer können über alle Themen schreiben, ohne wirklich hinterfragt zu werden. Ihren Texten wird eine Allgemeingültigkeit, eine Richtigkeit, und den Autoren eine „gute Recherchefähigkeit“ zugeschrieben, sodass sie die Deutungshoheit über viele Themen behalten.
Viele anderen bleiben in den Schubladen „Frauenliteratur“ und „Migrationsliteratur“. Karl Mays Erzählungen prägen bis heute das stereotype Bild von Native Americans, während viel zu wenige Bücher gefördert werden, die von Natives geschrieben wurden. Deshalb würde ich an meine obige Antwort anknüpfen und sagen, dass die Autor*innen gefördert werden sollten, die bisher viel zu oft wegfallen. Gleichzeitig gibt es die Normvorstellung des weißen cis männlichen Dichter und Denkers, der alles machen darf und kann, die hinterfragt werden muss.
Hast du Lesetipps, von Autor*innen, die wir unbedingt lesen sollten?
In dem Buch „Eure Heimat ist unser Albtraum“, herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah ist jeder einzelne Essay gut geschrieben und wichtig. Dann wäre mein Tipp, sich einfach mal anzuschauen, was die Autor*innen dieses Buches noch so geschrieben haben.
Vielen Dank für deine Zeit!
Das Interview führte Alisha Gamisch.