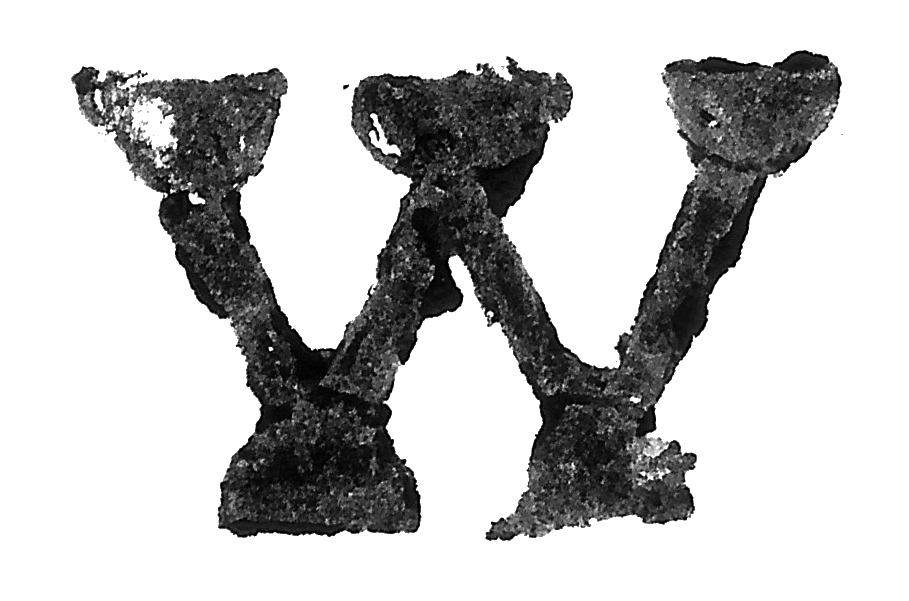Das Anekdoten-Archiv - Teil 2: Vielfalt, literarisches Denken und Politisierung
Wepsert hat eine neue Gastartikelreihe! Die beiden Autor*innen Lilian Peter und Alexander Graeff haben sich mit Fragen rund um den (un-)solidarischen Literaturbetrieb beschäftigt, damit, welches subversive Potential Anekdoten als literarische Form haben und damit, welche Möglichkeiten es gibt, wie sich Autor*innen und andere Teilnehmende des Literaturbetriebs verorten und verhalten können, um ihn solidarischer zu machen.
Das Gespräch soll zu mehr Solidarität unter Kolleg*innen aufrufen. Es lohnt sich, am Ball zu bleiben: Denn am Ende, d. h. nach dem dritten Teil des Gesprächs, das im zweiwöchentlichen Rhythmus erscheint, gibt es eine Einladung zum Mitmachen, zum Aufschreiben, zum Einschalten – das Anekdotenarchiv wird eröffnet. Vielleicht können so Veränderungen in den Strukturen des Betriebs möglich sein?
Hier kommt Teil 2 des Gespräches:
Lilian: Wir waren stehen geblieben beim binären Denken. Mit welcher Art von Körper ein Text assoziiert wird, hat ja direkte Auswirkungen auf seine Rezeption. Ich will dazu eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert, das war vor #metoo und bevor es dort zwei Professorinnen gab. Man musste erst eine Vorauswahlrunde bestehen, dann wurde man zu einem Gespräch eingeladen. In meinem Fall hat dieses Gespräch über eine Stunde gedauert. Ich saß im Raum mit fünf oder sechs Männern. Drei Professoren, der Geschäftsführer, ein oder zwei Hiwis. Einer der Professoren führte das Gespräch. Bereits mit der ersten Frage ging er mich unglaublich aggressiv an. Der Text, den ich eingereicht hatte, hatte offensichtlich irgendetwas in ihm getriggert. Es war ein äußerst konkretistischer, erzählerischer Text mit surrealen Elementen und philosophischer Grundierung. Es gab eine Zeit, da war so ein philosophisch grundiertes Schreiben quasi literarischer Standard. Von Männern, wohlgemerkt. Wenn man als Frau an diese alte Urdomäne männlicher Textherrschaft rührt, löst das bis heute mitunter unsägliche Reflexe aus. Der Professor warf mir alles Mögliche vor, dass ich nur Derrida in Literatur ummünzen wolle usw. Ich hatte damals keine einzige Zeile von Derrida gelesen. Der Mechanismus hinter seiner Aggression scheint mir heute völlig klar: Zum einen habe ich als Frau – oder als weiblich gelesener Körper – kein Recht, diesen Raum zu betreten, den die Philosophen gerne “Denken” nennen. Oder: Ich darf ihn betreten, aber nur als hinzukommendes, an sich entbehrliches Schmuckstück, als Illustratorin, als Nachahmerin. Zum anderen wird es einer aber auch schlicht nicht zugetraut. Er ging davon aus, dass es so gewesen sein musste, dass ich zuerst Derrida auswendig gelernt und dann danach gedacht hatte, jetzt schreibe ich mal einen Text, der diesen Derrida irgendwie verwurstet. Das, was später kommt, das Zweite, nicht das Erste, das Angehängte, Nachträgliche – das sollte mein Text sein, ein hübsches Frauchen am Herd. Das war der Text aber nicht, und das machte ihn völlig fuchsig. Hier haben wir das Binäre wieder: Es gibt das Erste, und es gibt das Zweite. Das denkende Selbst und das schattenhafte Andere. Das Original und das Nachgemachte. Ich fand seine Fragen völlig bescheuert, manieriert, sinnlos, an meinem Text vorbei – und irgendwann musste ich nur noch lachen.
Alexander: Der wirksamste Bannzauber der Hexen, Männer auslachen.
Lilian: Ich konnte ihn überhaupt nicht ernst nehmen. Das machte ihn natürlich noch aggressiver. Um es kurz zu machen: Er wollte aufgrund des katastrophalen Gesprächs nicht, dass ich angenommen werde. Später dann im Seminar lobte er die Studenten immer für ihre originellen Ideen, die Studentinnen für ihre schönen Stimmen, die sich so gut fürs Vorlesen eignen würden. Das ist jetzt zehn Jahre her, manches hat sich getan seitdem, an vielen Stellen hat sich aber auch gar nichts verändert. Als weiblich gelesener Text/Körper, der sich herausnimmt, an alte männliche Domänen zu rühren, muss frau permanent auf der Hut sein. Um die Ecke lauert immer ein Typ, der dich mundtot machen will, der dich bei lebendigem Leib begraben will, häufig genau dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Häufig ist es sogar einer, der dich erst zu fördern schien. Oder, wenn er dich nicht gleich mundtot machen will, zumindest einer, der dir mal ganz “grundsätzlich” (und gerne voller Wut) erklärt, wie die Welt funktioniert. Das ist ein so simpler wie trauriger Mechanismus, und er ist heute so aktuell wie seit jeher. Daher: Du musst dir gewiss sein können, dass du Verbündete hast. Wirkliche Verbündete, ganze Netzwerke von Verbündeten. Inzwischen sind solche Felder sichtbar und greifbar. Sie werden größer und größer. Das ist etwas, das sich wirklich geändert hat, und nichts ist wichtiger. Je mehr Verbündete du hast, desto weniger gelingt es diesem hässlichen alten Mechanismus, dich dem Erdboden gleichzumachen.
Alexander: Alle als abweichend gelesenen Körper mussten (und müssen es noch) vor den eingeschliffenen Mustern des patriarchalen, hierarchischen und exkludierenden Menschenbildes auf der Hut sein. Heute kann ein nonbinärer Körper mit einem queeren Roman den Deutschen Buchpreis gewinnen. Das ist toll, ist im deutschsprachigen Literaturbetrieb aber noch nicht lange so. Da ich ja auch in alten männlichen Domänen sozialisiert wurde, kenne ich dieses Auf-der-Hut-sein gut. Vor zehn, fünfzehn Jahren noch überlegte ich mir in bestimmten Situationen immer zweimal, was ich sage. Darauf hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Natürlich war das nicht allein meine Dynamik, auch die Gesellschaft hatte sich verändert. Der nicht-markierte Standard des weißen, cis-heterosexuellen, christlichen Mannes wurde endlich benannt und machtkritisch herausgefordert. Das half mir, mich zu politisieren. Ich begann, über (meine) Literatur zu sprechen und zu schreiben, also auch darüber, wie ich sie deute – politisch nämlich. Das löste mitunter Enttäuschung aus, und ja, auch unterirdische Kommentare auf Social Media und Schimpftiraden per E-Mail. Ein langjähriger Leser meiner Texte entpuppte sich als grantiger Troll, der mir vorwarf, ich würde mich “vor den Karren des Genderismus” spannen. Ihm reichte nicht eine E-Mail, das kundzutun, er belästigte mich gleich mit einer ganzen Burschenschaft an E-Mails. Ein Berliner Veranstalter nannte meine kulturpolitischen Aktivitäten wegen ihrer sozialkonstruktivistischen Grundierung nicht nur “gefährlichen Relativismus”, auch die Deutung meiner eigenen Literatur sei “unredlich”. Ich hatte das Unfassbare gewagt: Ich war nicht derselbe geblieben, hatte mich verändert und meine Haltungen modifiziert.
(c) privat
Es gab aber auch unterschwellige Reaktionen, Mikroaggressionen, die deutlich machen, wie stark wir bestimmte Muster von Gewalt internalisiert haben. Trotz oberflächlicher Offenheit gegenüber abweichenden Perspektiven war häufig gar keine Reflexion, geschweige denn Empathie möglich. Die am meisten belastende Erfahrung aber war, dass sich unter einigen queeren Kolleg*innen die Vorstellung einer Binarität “Wir vs. die anderen” ausgeprägter zeigte als im heteronormativen Teil des Literaturbetriebs. Nicht nur mein politisches Engagement, das mein Schreiben seit einiger Zeit begleitet, auch meine Bisexualität war dann Anlass einer krassen Ausschlussdynamik, die ich zu spüren bekam. Wieder die beiden Stühle – und klassische Bi-Erasure.
Jedenfalls: Für die Aussage, mit der ich nie sparsam umgegangen bin, dass der Betrieb konservativ sei, habe ich viel Kritik geerntet. Das sei doch “keinesfalls” so, woher ich diese Behauptung nehmen würde, hieß es dann immer. Die Literatur sei doch so frei und experimentell und avantgardistisch und egalitär mit ihrer Kontinuität von Goethe über Brecht bis Kehlmann.
Lilian: Kehlmann als avantgardistisch, das ist nun wirklich lustig.
Alexander: Das war jetzt eine beliebige Boys Club-Reihung, ich hätte statt Kehlmann auch Hettche einsetzen können. Aber in dem Wort “avantgardistisch” verbirgt sich schon auch ein allgemeiner Innovationsdruck, der im Literaturbetrieb bis heute wirksam ist.
Lilian: Einerseits ja, andererseits haben wir aber ja auch schon darüber gesprochen, wie schwierig es ist, avantgardistische Textformen – womit ja heute meist einfach so etwas gemeint ist wie “ungewöhnlich, ungängig” – unterzubringen. Der Betrieb ist da im höchsten Maße ambivalent, er zeichnet sowas gern aus, nimmt es aber eigentlich nur auf, wenn er es gut thematisch bewerben und dazu am besten noch das Label “Roman” draufkleben kann. Ich finde die Auszeichnungen für Blutbuch zum Beispiel super und freue mich darüber, gleichzeitig ist aber, wie du ja auch schon meintest, problematisch, wie dieses Buch stilisiert wird. Anders als die Vermessung der Welt, wo lauter Klischeebilder aktualisiert werden, kann man Blutbuch aber tatsächlich avantgardistisch nennen.
Alexander: Ja. Deutschsprachige Literatur, heißt es immer, sei doch per se ein offenes Feld. Ich bekam die Empfehlung, meine Lesereihe ‚Schreiben gegen die Norm(en)‘ doch einfach Dichtung zu nennen. Der Gegenwind war oft so vehement, dass ich unsicher wurde und dachte, dass manche Einschätzung vielleicht doch nicht zutreffend sei. Dass ich vielleicht doch zu viel Geschichte und Soziologie studiert habe, anstatt Goethe, Brecht, Hettche oder Kehlmann zu lesen. Als ich dann beim ersten Kongress des PEN Berlin, der sich explizit für Diversität, Multiperspektivität und einen offenen Diskurs im Literaturbetrieb stark macht, die Cancel-Culture-Rede von Ayad Akhtar hörte, waren alle Zweifel an meiner Aussage beseitigt. Ich denke, das soziale Milieu des deutschsprachigen Literaturbetriebs lässt sich im Großen und Ganzen mit dem Etikett “liberal-konservativ” versehen.
Lilian: Das gilt auch hinsichtlich der Frage, welche Formen von Literatur überhaupt durchdringen und für veröffentlichenswert befunden werden. Ich war mal eine Zeit lang in New York. Dort habe ich literarisch auf eine Weise aufgeatmet, die ich mir vorher nicht einmal vorstellen konnte. Es gibt im literarischen Amerika einen “spirit”, den ich als extrem aufgeschlossen empfinde, als neu- und denkgierig im positivsten Sinne. In Deutschland bleibt man dagegen immer gern auf dem sitzen, was man bereits kennt.
Alexander: Auf einem der beiden Stühle.
Lilian: Genau. Und man beharrt auch immer auf einer Trennung dieser Stühle. Dazu gehört zum Beispiel auch die Idee, dass etwas entweder Literatur sein müsse oder Sachbuch. Literatur oder Theorie. Hübsche Geschichte oder denkende Auseinandersetzung. Hauptsache, es wird nichts durcheinander gebracht. Wie langweilig! Ich würde Leuten oft gern nahelegen, ein bisschen Lektüre in Schreibtraditionen nachzuholen, die nicht rationalistisch geprägt sind. Denn das beharrliche Entweder-oder entstammt der rationalistischen Tradition und ergibt zusammen mit kapitalistischem Vermarktungswahn eine für die Vielfalt der Literatur sehr ungute Mischung.
Du merkst vielleicht, dass ich das Wort “patriarchal” vermeide, weil es sofort Reflexe hervorruft und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Sache häufig eher verhindert als befördert. “Patriarchal” und “rationalistisch” sind nicht deckungsgleich, in der westlichen Welt aber eng verwoben. Ich habe letzten Sommer auf ZEITonline einen Text mit dem Titel Der Text als Beutel, nicht als Waffe veröffentlicht. Die Redaktion hatte ihn mit dem Teaser versehen “In Deutschland dominiert die patriarchale Idee des Romans”. Ich habe für den Text enorm viel Zustimmung und Zuspruch bekommen, in Kommentaren und sozialen Medien gab es aber gleichzeitig auch die wildesten Reflexe auf eben diese Unterüberschrift, die eben nicht mal von mir stammte. Aber das wissen Leser*innen natürlich nicht. Was für ein Unsinn das sei, man denke nur an Virginia Woolf. Das ist natürlich etwas witzig. Denn zum einen ging es um den deutschsprachigen Literaturbetrieb, zum anderen ging es um die Gegenwart und nicht um die Literatur vor 100 Jahren. Außerdem bedeutet die Aussage ja überhaupt nicht, der Roman als solcher sei eine patriarchale Idee. Dass etwas dominiert, heißt ja nicht, dass es nichts anderes gibt. Und die Behauptung, dass die patriarchale Idee von etwas dominiert, heißt auch nicht, dass die Form selbst immanent patriarchal sei. Es heißt lediglich, dass es eine patriarchale Form davon gibt, und dass diese eben im Marktgeschehen dominiert. Mehr ist damit nicht gesagt, und abgeschafft werden soll auch nichts. Eigentlich gibt es überhaupt nichts, worüber man sich aufregen müsste.
(c) privat
Alexander: Da sagst du was. Die meisten Streitigkeiten entzünden sich genau daran. Viele verstehen einfach nicht, dass eine Aussage nicht zwingend eine zweite oder dritte Aussage ausschließen muss. Die Vorstellung, dass viele Aussagen nebeneinander stehen und Wahrheitsgehalt haben können, geht in viele Köpfe nicht rein.
Lilian: Ja, ich will dann immer zurückrufen, ey Leute, belegt mal einen Kurs in formaler Logik, das könnte uns echt viel ersparen. Was impliziert eine Aussage, was impliziert sie nicht? Was ist womit gesagt oder eben auch nicht gesagt? Wenn es eine Sache gibt, die man im Philosophiestudium ja wirklich lernt, dann das. Der Roman “an sich” kennt natürlich alle nur denkbaren Formmöglichkeiten. Wovon ich sprach, war ja unter anderem genau das: Formen, die nicht einem bestimmten Muster entsprechen, haben es im deutschsprachigen Literaturbetrieb heute sehr schwer. Dieses “Muster” ist eine komplexe Mischung aus patriarchalem, rationalistischem, christlichem, populär-realistischem, kapitalistischem Denken und Imaginieren. Klar gälte es eigentlich, erstmal genau zu beschreiben – und auf Seiten der Leser*innen zu fragen statt gleich reflexhaft abzuwehren –, was damit genau gemeint ist. Das ist aber zu komplex, um es in wenigen Zeilen zu tun, dafür braucht es mehr Raum, als ein Online-Zeitungsartikel ihn bietet. Das lässt sich nicht mit ein paar Schlagworten abklären. Wer es genauer wissen will, muss sich die Mühe machen, ein paar Bücher zu lesen und Gedankengänge etwas eingehender mitzuverfolgen. Das Unerträgliche an manchen Diskursen ist in meinen Augen, dass viele zu denken scheinen, es gebe so etwas wie eindeutige Fragen und eindeutige Antworten. Literatur und Denken müssen doch genau dort dazwischen gehen. Stattdessen gibt es einen eigenartigen Zeitgeist, der immer noch mehr vermeintliche Eindeutigkeit will, wenig Phantasie hat und überhaupt nicht von Zukunft zu träumen scheint. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Alexander: Bei aller Kritik und auch Sensibilität für die Verhältnisse, es geht mir oft so, dass ich die negativen Erfahrungen und Anekdoten, die die Probleme deutlich machen könnten, vergesse. So, als würde sich mein Körper nicht belasten wollen mit einer Ausgrenzungserfahrung zum Beispiel. Wenn ich die Anekdoten nicht sofort notiere, fallen sie mir nach ein paar Tagen aus dem Kopf. Das betrifft vor allem bestimmte Wörter oder Sätze. Ich vergesse oder verdränge unbewusst, was eine Person genau gesagt hat. Ich registriere, dass sich ihre Wörter oder Sätze nicht gut anfühlen, kann sie aber später nicht mehr wiedergeben. Kennst du das?
Lilian: Das ist ja interessant – und vielleicht auch ziemlich gesund? Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich vergesse gar nichts, auch nicht die Anekdoten, die andere mir erzählen. Sie brennen sich mir regelrecht ein. Manchmal fühle ich mich fast wie ein Container (ha, der Container wieder). Wenn ich besonders angreifbar bin, wache ich sogar nachts auf und kann nicht wieder einschlafen, weil mir eine Geschichte nicht mehr aus dem Kopf geht. Das muss, wie gesagt, überhaupt keine Geschichte sein, die mich selbst betrifft. Es menschelt sehr im Literaturbetrieb, es gibt leider allzu viele, die gern raushängen lassen, dass sie am vermeintlich längeren Hebel sitzen. In meiner Erfahrung sind das tatsächlich meistens Männer (und zwar meistens solche ab der Boomer-Generation, jüngere sind anders sozialisiert), und die, die es merklich anders zu machen versuchen, sehr oft Frauen. Nicht immer, aber sehr oft. So etwas wie einen Betriebsrat gibt es ja nicht. Dazu kommt bei vielen natürlich auch die Angst, dass ihnen Schaden zugefügt wird, wenn sie Unbequemes öffentlich erzählen. Die meisten sind ziemlich allein unterwegs und fühlen sich wahrscheinlich auch häufig ziemlich machtlos.
Im nächsten Teil sprechen Lilian und Alexander weiter über den Körper als Anekdotencontainer, Körper(un)durchlässigkeiten, nochmal über Ausschlussdynamiken, Produktionsverhältnisse im Literaturbetrieb, das Buch als intersubjektives und intertextuelles Gewebe, die Notwendigkeit von Verbündeten – und laden ein, mitzuschreiben am offenen Anekdoten-Archiv.
Zu Teil 1 des Gesprächs geht es hier.
Zu Teil 3 hier.
Alexander Graeff (c) Natalja Reich
Alexander Graeff ist Schriftsteller und Philosoph. Er arbeitet auch als Literaturvermittler und Dozent im diskriminierungs-kritischen, interreligiös-weltanschaulichen Dialog. Er schreibt Lyrik und Prosa sowie philosophische und literatursoziologische Essays, u. a. für die Frankfurter Rundschau. Er ist Leiter des Programmbereichs Literatur im Berliner Kunst- und Kulturzentrum Brotfabrik sowie Initiator der Lesereihe »Schreiben gegen die Norm(en)?«. In der Queer Media Society engagiert er sich für mehr Sichtbarkeit queerer Personen und Stoffe im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Er lebt in Berlin und Greifswald. Aktuelle Veröffentlichungen sind »QUEER« (Essay, Verlagshaus Berlin, 2022) und »Diese bessere Hälfte« (Erzählung, Herzstückverlag, 2023).
Lilian Peter (c) Achim Lengerer
Lilian Peter ist Schriftstellerin, Philosophin und Übersetzerin. 2017 erhielt sie den Edit Essaypreis, es folgten Stipendien der Villa Kamogawa in Kyoto/Japan, des Künstlerhaus Edenkoben sowie des Berliner Senats. Über die gesamte Pandemie-Zeit hinweg lief ein Briefwechsel mit der japanischen Schriftstellerin Yui Tanizaki, die Texte wurden von Literaturübersetzerinnen laufend jeweils ins Deutsche bzw. Japanische übersetzt (nachlesbar auf der Webseite der Villa Kamogawa). Im Wintersemester 23/24 Gastdozentur am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Ihr aktuelles Buch »Mutter geht aus«, ein Band mit poetischen Essays, die sich auf erzählerische, vielfach verschachtelte Weisen mit Fragen des Erinnerns, Erzählens, Reisens und damit zusammenhängenden Zuschreibungen an weiblich gelesene (Text-)Körper beschäftigen, erschien im März 2022 bei diaphanes.