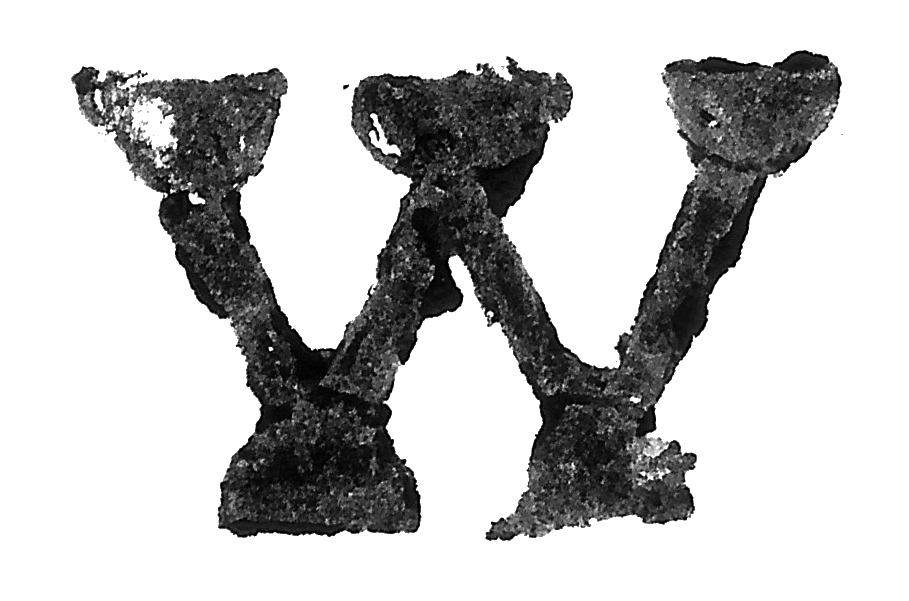Das Anekdoten-Archiv - Teil 1: Körper, Sprache und Identität
Wepsert hat eine neue Gastartikelreihe! Die beiden Autor*innen Lilian Peter und Alexander Graeff haben sich mit Fragen rund um den (un-)solidarischen Literaturbetrieb beschäftigt, damit, welches subversive Potential Anekdoten als literarische Form haben und damit, welche Möglichkeiten es gibt, wie sich Autor*innen und andere Teilnehmende des Literaturbetriebs verorten und verhalten können, um ihn solidarischer zu machen.
Das Gespräch soll zu mehr Solidarität unter Kolleg*innen aufrufen. Es lohnt sich, am Ball zu bleiben: Denn am Ende, d. h. nach dem dritten Teil des Gesprächs, das im zweiwöchentlichen Rhythmus erscheint, gibt es eine Einladung zum Mitmachen, zum Aufschreiben, zum Einschalten – das Anekdotenarchiv wird eröffnet. Vielleicht können so Veränderungen in den Strukturen des Betriebs möglich sein?
Hier kommt Teil 1 des Gespräches:
Lilian: Lieber Alexander, wir haben uns verabredet, ein Gespräch über Produktionsverhältnisse, Diskriminierungen, Willkürlichkeiten, Zumutungen und Machtverhältnisse im Literaturbetrieb zu führen. Denn es herrscht Frustration – unter Schreibenden, aber auch unter jüngeren, gerade erst in die Verlagsbranche eingestiegenen Lektor*innen und Agent*innen.
Alexander: Ich denke, dass die meiste Frustration durch das schiefe Machtverhältnis zwischen der hegemonialen Perspektive und bis dato marginalisierten Stimmen oder Identitäten zustande kommt. Trotz der Veränderungen in den letzten drei Jahren werden überkommene soziale Normen durch die Strukturen des Literaturbetriebs nach wie vor aktualisiert.
Lilian: Ja, und dazu gehört auch die Frage der literarischen Vielfalt an Formen, Erzählweisen, Erzählhaltungen. Das ist in meinen Augen untrennbar verbunden. Mich persönlich interessiert eher weniger die Frage nach Identitäten und Identitätsgeschichten, weil ich “Identität”, oder genauer, die Idee, dass es so etwas gebe wie eine eindeutige Identität, generell für ein sehr problematisches Konstrukt halte. Dabei gibt es natürlich wichtige Fragestellungen, die Identitäten betreffen, zum Beispiel: Wer urteilt wie über einen Text, und warum? Was hat dieses Urteil möglicherweise zu tun mit der Assoziation des*der Urteilenden in Bezug auf den Körper der Person, die den Text geschrieben hat, oder mit Körpern, die im Text beschrieben werden? Vordergründig interessiert mich immer der Text selbst: Was wird mir darin erzählt, welche Figuren kommen wie vor, welches Wagnis geht ein Text ein, von welcher Welt erzählt er, wie erzählt er?
Wir haben einen kapitalistisch durchtränkten Literaturbetrieb, der in der westlichen Welt zudem historisch verschränkt ist mit einer rationalistisch-realistisch-christlichen Erzähltradition, die immer auf ein großes, wahres Ganzes zielt und in der man nicht sonderlich viel mit, zum Beispiel, animistischen Erzählansätzen oder kurzen Literaturformen anzufangen weiß. Vermeintlich jedenfalls. Denn ich glaube, dass sich das mit nachkommenden Generationen gerade extrem ändert, aber sie stoßen allerorten auf etablierte Bollwerke. Ich würde durchaus die These aufstellen: Eine fremde, wirklich andere Welt kann nicht erzählt werden, wenn immer nur die bereits bekannten Erzählmittel zum Einsatz kommen. Wird aber versucht, andere Formen unterzubringen, so gibt es einen merkwürdigen Konsens unter Verlagsmenschen, was angeblich alles nicht “gehe” – und unter Agent*innen, was die Verlagsmenschen angeblich nicht “durchlassen” würden. Nachwuchs-Lektor*innen verstehen aber oft auch nicht, warum der Chef-Lektor mit den Augen rollt, wenn wieder jemand Kurzprosa einreicht statt den erwünschten Roman. Die finden das frustrierend, aber sie sind auch machtlos. Gleichzeitig wurden in den letzten Jahren hier und da Bücher publiziert, die Anlass geben könnten, zu sagen, hey, da passiert doch was. Zum Beispiel, ein sehr prominentes Beispiel: Kim de l’Horizons Blutbuch wurde mit dem Deutschen und dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Was sagst du dazu?
(c) privat
Alxander: Ich finde das eine schöne Entwicklung. Die Auszeichnungen für Blutbuch sind in mehrerer Hinsicht eine Bereicherung für den deutschsprachigen Literaturbetrieb. Wegen der experimentellen Form des Textes und natürlich wegen des Inhalts und der Ansätze, die darin verhandelt werden. Mir persönlich gefallen vor allem die neomaterialistischen Bezüge. Und auch in politischer Hinsicht zeugt die Anekdote rund um Kim von einer größeren Durchlässigkeit von queeren und nicht-bildungsbürgerlichen Perspektiven in der Literatur. Bei zwei Deutungen des Falls wäre ich allerdings vorsichtig: Zum einen ist Blutbuch kein identitätspolitisches Ereignis, wie es in den Medien mitunter präsentiert wurde. Zum anderen ist es nicht das erste queere, nonbinäre oder experimentelle Buch auf dem deutschsprachigen Markt. Große, eher traditionelle Verlage wie DuMont, wo Blutbuch ja erschienen ist, werden oft für ihren Mut gelobt, wenn sie queere Stimmen in ihre Programme aufnehmen. Dieser Hype macht die Jahrzehntelange Arbeit von queeren Independent-Verlagen genauso unsichtbar wie den mühsamen Kampf so vieler queerer Autor*innen im heteronormativ und bildungsbürgerlich grundierten Literaturbetrieb.
Lilian: Dasselbe gilt, was weniger gängige Textformen betrifft. Wenn ein großer Verlag heute ausnahmsweise mal sowas bringt, wird er gefeiert. Für kleinere Verlage mit ihrer kontinuierlichen Arbeit ist es dagegen zunehmend schwer, überhaupt noch Besprechungsplätze im Feuilleton zu bekommen.
Alexander: Sicher, wobei ich bei queerer Literatur auch an verqueerte Textformen denke. Was du generell über Identitäten sagst, teile ich im Übrigen. Ich habe zwar kein Problem mit der Vorstellung, Identität sei eine lebenslange Erzählung. Sich im Kampf für mehr Sichtbarkeit marginalisierter Perspektiven und Stimmen aber auf eines der wirkmächtigsten Schwergewichte der abendländischen Philosophie zu beziehen, finde ich schon kritikwürdig. Mit dem Identitätsbegriff kommt ja die Vorstellung einer essenziellen Einheit der Person, die nicht nur als Ursprung der Wirklichkeit angesehen wird, sondern sich auch erst in der Abgrenzung zum Anderen legitimiert.
Lilian: Und umgekehrt geht damit auch immer die Vorstellung einher, dass man sich aus einer gegebenen Wirklichkeit heraus auf einen solchen einfachen “Ursprung” beziehen könne, um von dort aus eine bestimmte Herkunft zu erzählen. Man darf nicht vergessen, dass eben eine solche Bezugnahme auch eine Herkunft hat, also selbst perspektivisch ist, und das, worauf man sich bezieht, in gewisser Weise auch überformt. Das haben die alten Philosophen natürlich gesehen, bis hierher kamen sie fast immer. Wobei ich einwerfen will, dass es in dieser Geschichte auch viele tolle Ausreißer gibt, zum Beispiel im Mittelalter, und ab Nietzsche sowieso. Was nichts daran ändert, dass die Binaritätsgeschichte mit Ich/Welt oder Selbst/Anderes bis heute die dominierende Geschichte ist. Wahrscheinlich ist sie so machtvoll, gerade weil sie hierarchisch funktioniert.
Alexander: Genau. Und die Ausreißer, also die Abweichungen von der Norm, benötigen in dieser Geschichte immer Erläuterung, müssen hervorgehoben und damit markiert werden. Denn die Hervorhebung der Abweichung legitimiert erst den unmarkierten Standard, die Norm. Philosophisch gesehen ist der Identitätsbegriff also das gerade Gegenteil fluider, situierter und nonbinärer Vorstellungen vom Subjekt. Auch Kim de l’Horizon betont ja, dass es dey nicht um Identitäten gehe, sondern um Erfahrungsmöglichkeiten – ein im Übrigen auch gravierender Unterschied zwischen Queer Theory und manchem queerpolitischen Aktivismus.
Du sagst, dass dich vordergründig der Text interessiert. Ich würde ihn von den Personen, die ihn produzieren und rezipieren, aber nicht trennen. Auch nicht von den sozialen Kontexten, aus denen heraus Personen ihn produzieren. Dieser Zusammenhang wird oft vergessen in der Literaturkritik und im Verteilungsmodus des Betriebs. Im Text sind im Grunde die Normen der Mitwelt geronnen, er ist auch Medium eines sozialen wie literarischen Kommunikationsprozesses, der die Normen aktualisiert oder herausfordert. Dasselbe gilt für literarische Normen, z. B. der Romanstandard oder die Scheu vor Lyrik. Auch das ist im Text enthalten.
Lilian: Die Scheu vor Philosophie oder vor komplexerer Vielschichtigkeit in literarischen Texten!
Alexander: Bestimmt auch das. In sozialer Hinsicht ist der Text ein Normengefäß oder -container. Vielleicht ist mein Blick zu soziologisch, aber, wenn ich ehrlich bin, interessieren mich die Personen im und rund um den Text mehr als die im System ‚Literatur‘ verhandelten Objekte, also Bücher, Preise, Rezensionen.
Lilian: Ja, wir sind uns da ganz einig: Der Text lässt sich nicht trennen von seiner Situiertheit, seiner Gemachtheit. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, der Text ist selbst ein Körper oder wird jedenfalls als ein Körper rezipiert. Er ist also eigentlich mehr als ein Container oder Gefäß, er ist selbst lebendig.
(c) privat
Alexander: Personen sind ja auch irgendwie Normencontainer. Seit unserer Kindheit werden wir mit Normen gefüllt, und doch besitzen wir eine Eigendynamik. Wir können uns zu den Normen verhalten, sie tradieren oder dekonstruieren, wenn wir merken, dass sie in unserer Mitwelt nicht aufgehen, wenn sie den Standard, den sie versprechen, nicht einlösen. Das gilt vielleicht auch für Texte.
Lilian: Ja, wobei ich die Idee, dass Körper/Texte erstmal leer oder unschuldig sind und dann von außen gefüllt werden, schwierig finde, weil sie letztlich auch wieder mit einer Binarität arbeitet. Wahrscheinlich meinst du das gar nicht, aber das Bild des Containers ruft das ein bisschen auf. Ich denke, die Interaktion zwischen zwei Polen, Körper und Welt, Norm und Text usw., ist sehr komplex und läuft zu großen Teilen unbewusst ab. Sie ist weder einseitig noch nur “schlecht” – sie sorgt ja auch dafür, dass wir uns überhaupt erst in dieser Welt bewegen können. Der Körper/Text ist ja von Anfang an schon Teil der Welt und nicht erst von ihr getrennt, um dann später eine Verbindung einzugehen.
Alexander: Nichts ist unschuldig, alles ambivalent. Wenn ich statt des Begriffes “Container” den Begriff “Medium” gesagt hätte, hättest du es wahrscheinlich anders verstanden, weil wir mit Medien immer schon eine Mehrdeutigkeit verbinden, die Interpretation ermöglicht. Beim Container wittern wir Passivität, weil wir generell Objekte als passiv wahrnehmen. Das haben wir so gelernt. Die Welt und ihre Objekte darin sind meiner Überzeugung nach aber nicht passiv. Nur, weil wir erkenntnismäßig keinen Zugriff auf sie haben, müssen sie ja noch nicht gleich passiv sein. Dem Text kann also diese Eigendynamik nicht deswegen zugeschrieben werden, weil ihn die Kunst- und Literaturtheorie als Medium tradiert hat, sondern weil er ein Objekt ist. “Container” ist ein Wort, das mich in meinem lyrischen Schreiben gerade sehr umtreibt, und das ich auch mit Ursula K. Le Guins Tragetaschen-Theorie verbinde. Würdest du vor dem Hintergrund dieses Essays sagen, die Tragetasche sei passiv?
Lilian: Interessante Frage, die ich auf jeden Fall verneinen würde. Ich denke die Tasche generell nicht als etwas dem Text/Körper Externes, sondern tatsächlich als Körperteil, als so etwas wie ein Lese-Organ vielleicht. Die Tasche ist auch ein geschlechtliches Symbol. Sie meint keine vollständige Einverleibung, aber auch kein feststehendes Außen. Die Tasche formt sich im Aufgreifen von etwas permanent selbst. Ich verstehe den Text immer gern als Körper im konkretesten Sinne: Er blickt, begehrt, spielt, kommuniziert, reagiert, verkehrt mit anderen Texten, Körperflüssigkeiten treten aus ihm aus, manches tut er auf offener Straße, anderes hinter Vorhängen, und so weiter. Es gibt keinen Text, der so etwas wie ein eindeutiges Geschlecht hätte (was immer das überhaupt sein sollte), aber jeder Text wird auch auf eine gewisse Weise geschlechtlich rezipiert, das heißt: Er soll ein eindeutiges Geschlecht, eine eindeutige Identität haben, allein schon, weil die Literaturbranche sonst nicht weiß, wie sie ihn bewerben und in welche Regalecke der Buchhandel ihn stellen soll. Interessant ist, dass dann bei wichtigen Literaturpreisen oft ein Text doch gerade wieder dafür gelobt wird, dass er sich irgendwie zwischen Genres bewege. “Genre” heißt ja übrigens nichts anderes als “Geschlecht”. Aber eben “zwischen Genres” – als bräuchte es erst unbedingt zwei Stühle, damit später gelobt werden kann, dass etwas zwischen diesen Stühlen steht. Oder hockt. Oder hocken gemacht wird. Und dort soll es dann aber bitte auch hocken bleiben. Ich bin stattdessen fürs Gehen, dafür sind Körper gemacht. Das können sie gut. Beim Stehen oder Sitzen meldet sich bekanntlich irgendwann das Kreuz.
Alexander: Das Zwei-Stühle-Bild beschreibt ja treffend das gängige Denken, nicht nur in der Literatur. Und dieses lebenslange Hocken-bleiben auf einem der beiden Stühle gilt dann oft auch als normal. Ganz gleich ob Mehrheitsgesellschaft oder marginalisierte Gruppen, gefühlt wollen alle normal sein. Sich zwischen den Stühlen zu bewegen oder einen dritten, vierten hinzuzunehmen, wird als Störung empfunden. Normalitätsempfindung ist identitätsstärkend – und das ist ein Problem. Denn sie stärkt das binäre Weltbild: Ich/Welt, Körper/Geist, Mann/Frau, Homo/Hetero, Mensch/Tier, usw. usf.
Im nächsten Teil des Gesprächs sprechen Lilian und Alexander über alte Männerdomänen, den Bannzauber der Hexen, grantige Trolle, die Wichtigkeit von Vernetzung, subtile und weniger subtile Ein- und Ausschlussmechanismen sowie erneut über das Entweder-Oder-Denken. Stay tuned!
Zu Teil 2 des Gesprächs geht es hier.
Alexander Graeff (c) Natalja Reich
Alexander Graeff ist Schriftsteller und Philosoph. Er arbeitet auch als Literaturvermittler und Dozent im diskriminierungs-kritischen, interreligiös-weltanschaulichen Dialog. Er schreibt Lyrik und Prosa sowie philosophische und literatursoziologische Essays, u. a. für die Frankfurter Rundschau. Er ist Leiter des Programmbereichs Literatur im Berliner Kunst- und Kulturzentrum Brotfabrik sowie Initiator der Lesereihe »Schreiben gegen die Norm(en)?«. In der Queer Media Society engagiert er sich für mehr Sichtbarkeit queerer Personen und Stoffe im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Er lebt in Berlin und Greifswald. Aktuelle Veröffentlichungen sind »QUEER« (Essay, Verlagshaus Berlin, 2022) und »Diese bessere Hälfte« (Erzählung, Herzstückverlag, 2023).
Lilian Peter (c) Achim Lengerer
Lilian Peter ist Schriftstellerin, Philosophin und Übersetzerin. 2017 erhielt sie den Edit Essaypreis, es folgten Stipendien der Villa Kamogawa in Kyoto/Japan, des Künstlerhaus Edenkoben sowie des Berliner Senats. Über die gesamte Pandemie-Zeit hinweg lief ein Briefwechsel mit der japanischen Schriftstellerin Yui Tanizaki, die Texte wurden von Literaturübersetzerinnen laufend jeweils ins Deutsche bzw. Japanische übersetzt (nachlesbar auf der Webseite der Villa Kamogawa). Im Wintersemester 23/24 Gastdozentur am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Ihr aktuelles Buch »Mutter geht aus«, ein Band mit poetischen Essays, die sich auf erzählerische, vielfach verschachtelte Weisen mit Fragen des Erinnerns, Erzählens, Reisens und damit zusammenhängenden Zuschreibungen an weiblich gelesene (Text-)Körper beschäftigen, erschien im März 2022 bei diaphanes.