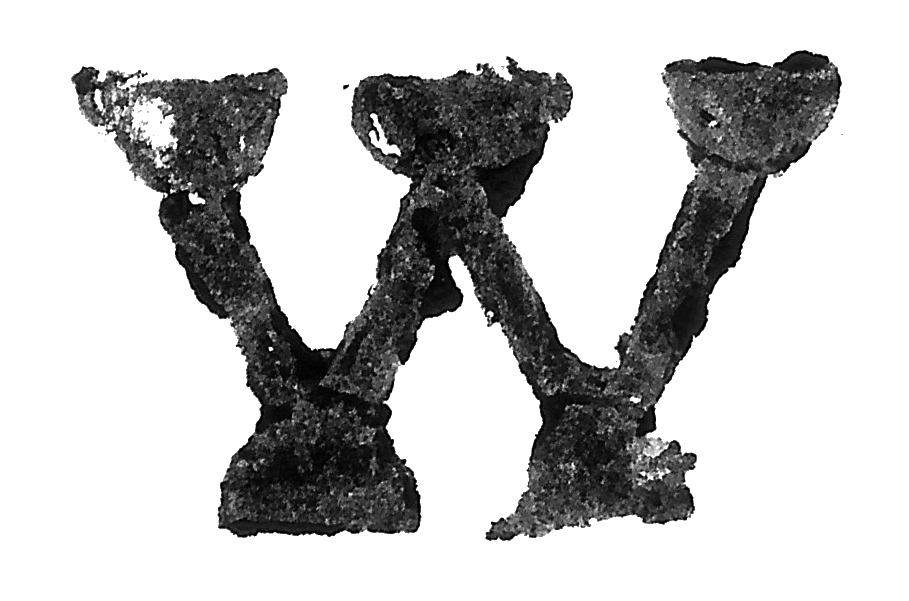Sollten wir keine Bücher von weißen Cis-Männern mehr lesen? Interview mit Sabine Scholl
Identity Politics (dt. Identitätspolitik) nennt man eine politische Sichtweise auf die Gesellschaft, die die Erfahrungen von Menschen unterschiedlicher Gruppenzugehörigkeiten (weiß/schwarz, Frau/Inter/Trans/Mann, hetero/homo, arm/reich, etc.) in den Vordergrund stellt. Die Annahme ist, dass unter diesen unterschiedlichen Gruppen aufgrund von lange gewachsenen verschiedenen Voraussetzungen und Rechten auch Priviegien ungleich verteilt sind.
So erlebt eine lesbische Frau andere Herausforderungen in ihrem Alltag, ihrer Karriere, ihrer familiären Situation als zum Beispiel eine hetero Frau. Es geht hier nicht um individuelle Erfahrungen, sondern Erfahrungen, die mit anderen lesbischen Frauen geteilt werden, also zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen, aber auch die spezifischen Erlebnisse, die damit einher gehen, als Frau eine andere Frau zu begehren oder in eine andere Frau verliebt zu sein. Häufig wird der Begriff Identitätspolitik daher auch mit einer sehr starken Begrenzung auf die einzelnen Gruppenzugehörigkeiten verknüpft und als negativ wahrgenommen.
Wenn wir aber beginnen, unseren Alltag mit dieser Sicht zu betrachten, wird offensichtlich, dass in unserer Gesellschaft der Fokus noch immer sehr stark auf Erzählungen weißer hetero Männer liegt.
Welche Bücher lesen wir, welche Stories speichern sich in unseren Köpfen ab? Geschichten können viel dazu beitragen, welche Entwicklung eine Gesellschaft nimmt, welche Probleme sichtbar und somit angegangen werden. Unsere neue Interviewreihe beschäftigt sich genau damit: Identität in der (Gegenwarts-)Literatur.
Sabine Scholl
Wepsert-Crew Member Alisha Gamisch hat als erste Interviewpartnerin Sabine Scholl in Berlin getroffen, erfolgreiche Autorin und Journalistin, die 2015–2017 Mitglied der Jury für den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt war und selbst Trägerin zahlreicher Literaturpreise ist. Zuletzt ist ihr Roman Das Gesetz des Dschungels im Secession Verlag erschienen.
Du hast zwei Jahre beim Internationalen Literaturpreis in der Jury gearbeitet. Wie wird man Jurorin bei einem Literaturpreis?
Ich bin Teil eines anderen Projektes gewesen, das am Haus der Kulturen der Welt stattgefunden hat, es ging da um Digitalität und Literatur und die Veränderung von Zugriff, Rezeption und Möglichkeiten über den deutschen Sprachraum hinauszugehen mit den Mitteln des Netzes. Darüber habe ich die Verantwortliche kennengelernt, die auch die Jury des Internationalen Literaturpreises zusammensetzt bzw. vorschlägt und so bin ich da hineingekommen.
Kannst du deine Erfahrungen in der Jury mit uns teilen? Wie sucht ihr aus?
Man bekommt sehr viele Einsendungen von den Verlagen und die arbeitet man dann alleine durch. Später gleicht man das mit den anderen Juroren und Jurorinnen ab, und da fallen schon einige raus, die zum Beispiel eindeutig Genreliteratur sind, oder etwas, das sehr weit hergeholt ist, zum Beispiel irgendein Affenforscher, der einfach seine Expedition beschreibt und man sich denkt: das ist jetzt wirklich keine literarische Verarbeitung.
Dann teilt man die verbliebenen Texte zu, jeder bekommt einen Stapel mit Büchern und jeder einzelne Juror und jede einzelne Jurorin sucht dann wieder aus, was sie am besten findet. Jeder erstellt wieder eine Shortlist und in so einem Diskussionsprozess wird das immer konzentrierter und konzentrierter und am Ende wird dann in einer finalen Diskussion eine Shortlist ausgewählt und daraus der Preis vergeben. Es ist wirklich sehr viel, aber ich lese ja gern und es ist auch schön so aus dem Vollen schöpfen zu können und viel zu lernen.
Welche Rolle spielen “Identity Politics” in dieser Arbeit, also wie stark achtet ihr auf ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter, der Klassenzugehörigkeit, der Hintergründe etc.?
Ich war ja in einer relativ traditionellen Besetzung in der Jury, also eine andere in der Jury, Leila (*Leila Chamaa; Anm. der Red.) eine Übersetzerin und ich waren die einzigen, die überhaupt auf sowas aufmerksam gemacht haben. Die anderen haben sich überhaupt nicht darum gekümmert, weder was die Autoren oder Autorinnen betrifft noch was das Sujet betrifft. Auch war die Darstellung der Geschlechterverhältnisse nie Thema, und wenn ich damit angefangen habe, dann hieß es immer gleich, ah ja, jetzt kommt wieder die Sabine, jetzt kommt sie wieder mit ihrem Geschlechterkram. Aber ich habs trotzdem oft geschafft in den Diskussionen, die Leute davon zu überzeugen, dass das eben nicht irrelevant ist, dass da doch etwas dran ist an den Einwänden, die ich habe, bzw. auch an den Vorschlägen.
Manchmal erntete ich auch totales Unverständnis. Bei einem Roman, der mir wirklich sehr gut gefallen hat, habe ich gesagt: ‚Das Tolle daran ist, dass er Wissenschaftlerinnen darstellt, die Hauptpersonen sind. Das ist in Romanen sonst sehr selten der Fall.’ Da haben die anderen geantwortet: ‚Das ist doch überhaupt kein Kriterium!’ So als hätte ich schon wieder so eine verrückte Anwandlung. Irgendwann konnten sie es dann mit Humor nehmen, und ich habs irgendwann auch mit Humor genommen, aber anfangs hab ich mich schon angegriffen gefühlt.
Man wird dann in so eine Ecke gestellt.
Genau. Und der Typ der mich immer so angegriffen hat … Ich meine, er hat nie sein Denken wirklich geändert, aber er hat zumindest manchmal eingestanden, dass ich doch Recht haben könnte. Er hat einen kleinen Lernprozess hingelegt, da war ich schon ein bisschen stolz. Leila und ich haben auf jeden Fall Akzente gesetzt und zwar ziemlich kämpferisch.
Wie ist dein Eindruck vom Verhältnis Mann-Frau in Jury Riegen?
Es gibt Studien dazu, zum Beispiel #frauenzählen vom PEN-Club. Da geht’s darum, welche Bücher veröffentlicht werden, welche Bücher von welchen Kritikern und Kritikerinnen besprochen werden und welche Bücher bepreist werden. In diesen Studien ist eindeutig, dass es da noch sehr viel aufzuholen gibt. Und auch weibliche Literaturkritiker wollen oft nicht darauf achten und wählen häufig Männer.
Du bist seit über 20 Jahren Teil des Literaturbetriebs. Hat sich, seitdem du angefangen hast, etwas in der Wahrnehmung von Frauen und Minderheiten, POCs und queeren Menschen und damit die Frage nach der Autorschaft im Literaturbetrieb geändert?
Ich glaube es ist eine Generationenfrage. Je jünger, desto offener ist man, auch durch seine eigene Sozialisation, außer man ist jetzt dezidiert konservativ erzogen worden. Aber die Tendenz ist schon im Kulturbetrieb, dass die jüngeren Verantwortlichen bereiter dazu sind, darüber zu sprechen, und immerhin wird jetzt diskutiert. Ob sich jetzt so schnell was ändert, ist eine andere Frage, aber es wird darüber gesprochen und das finde ich schon einen Fortschritt. Und jetzt fehlt nur noch, dass wir auch danach handeln.
Wie gehst du persönlich da heran, wenn du in der Auswahlposition sitzt? Steht die Literatur, der Text im Vordergrund oder auch die Person, die den Text geschrieben hat? Also es gibt ja Stimmen, die sagen: „Wenn wir darauf achten, dass Frauen und POCs gezielt gefördert werden, geht es nicht mehr nur um Literatur.” Es wird gefordert, dass ausschließlich der Text im Zentrum stehen muss.
Ja, aber es ist schon eine Frage, wie sich ein Kanon bildet. Sehr lange war gute Literatur, wenn sie von weißen älteren Männern irgendwelche Weltanschauungen vermittelt hat, und das vielleicht noch in einer ansprechenden poetischen Sprache, sag ich jetzt mal ganz polemisch. Das wurde als relevant angesehen.
Und das ist eben ein gesellschaftlicher Prozess, also die Frage, was als relevant angesehen wird.
Ist es irrelevant von einer Frau zu erzählen, die ihre Wohnung verliert und gezwungen ist, ihre Kinder alleine großzuziehen? Ist es relevant wenn jemand eine Geburt schildert - was ja sehr selten passiert - und warum passiert das so selten? Das sind alles wichtige Fragen. Früher, vor 30 Jahren, hätte man gesagt: „Ja, das ist eben Frauenliteratur, die so nebenher läuft’“ Aber die wirklich politischen Dimensionen, die steckten nicht in den Werturteilen drin. Dass das dann literarisch gestaltet sein muss, ist natürlich noch eine andere Sache.
Es gibt eine amerikanische Autorin und Kritikerin, Nicola Griffith, die untersucht hat, wer die Hauptfiguren bei den Bepreisten sind. Sie fragte nicht nur, ob das Buch von einem Mann oder einer Frau geschrieben wurde, sondern auch ob es von Frauen handelt. Am wenigsten Preise bekamen die Bücher, die von Frauen geschrieben wurden und auch von Frauen handeln. Diese alten Vorurteile, dass Frauen immer „nur“ über Gefühle oder Kinder nachdenken und heiraten wollen, die dafür sorgen, dass Menschen denken, dass Frauenleben irrelevant sind. Für mich ist es natürlich ein genauso wesentlicher Anteil an Leben und Überleben in unserer Gesellschaft, der von Frauen gefühlt, gedacht und formuliert wird, aber es gibt eben noch viele, die das nicht so sehen.
In meinem Studium in Deutschdidaktik, genauer bei der Leseförderung, haben wir eine Studie durchgenommen, die gezeigt hat, dass Jungen sich tendenziell nicht mit weiblichen Charakteren identifizieren können oder wollen. Die Lösung der Didaktiker*innen war nicht, zu versuchen da was an der Ursache zu ändern, sondern ihnen mehr Bücher anzubieten, die männliche Helden haben. Da hab ich gedacht, ist ja schön, dass sie dann mehr lesen, aber vielleicht sollte man sich auch fragen, warum sie sich nicht in Frauen oder Mädchen hineinversetzen können. Mädchen lesen nämlich auch gerne Bücher mit männlichen Hauptfiguren.
Ja, toll. Jugendbücher sind eh problematisch, ich kenne das von meiner Tochter. Das war wirklich ein Problem, als sie zu alt für die richtigen Kinderbücher war. Bei den Jugendbüchern, habe ich so wenig gefunden, das nicht klassische Jungen- Mädchenklischees bedient, und sich nicht nur um „ich will schön sein” und so was dreht. Da hab ich stundenlang gesessen und gesucht. Sie ist dann einfach gleich umgestiegen auf Erwachsenenliteratur.
Es gibt Stimmen, die plädieren dafür, weniger Preise zu vergeben und mehr Stipendien, um Konkurrenz im Literaturbetrieb abzubauen und bestimmte Strukturen zu durchbrechen.
Das halte ich für eine gute Idee. Die Preise bilden, so wie sie momentan sind, sehr viel willkürliche Einschätzungen ab, sie bilden eigentlich den Betrieb ab und sind nicht unabhängig. Es gibt bei den Jurys bei Preisen eine hohe Inflation. Klaus Kastberger, der selbst in vielen Jurys ist, hat mir erzählt, dass er privat gezählt hat, wer eigentlich wie oft in welchen Jurys war in einem Jahr und es kam raus, dass zum Beispiel Daniela Strigl in einem Jahr in über 25 Jurien war und da fragt man sich schon, ist das noch klug, immer dieselben Juror*innen einzusetzen? Es gibt so viele fähige Menschen, die das könnten, aber es sind immer die gleichen, die ernannt werden. Das finde ich sehr fragwürdig.
Und je diverser die Juries würden, desto diverser wären die Preisträger.
Zumindest kann niemand den ganzen Literaturbetrieb und alles, was literarisch gerade passiert, kennen, auch eine kompentente Kritikerin wie Daniela Strigl nicht.
In einem Interview, das du in der PS (Politisch Schreiben - Anmerkungen zum Literaturbetrieb, eine Literaturzeitschrift aus Leipzig) gegeben hast, erzählst du, dass du es damals, als du mit der Literatur begonnen hast, schwer fandest, weibliche Solidarität zu finden. Kannst du das nochmal erklären?
Ich habe das Gefühl, dass die männlichen Seilschaften besser funktionieren, dass sie sich über lange Zeit besser unterstützen als Frauen. Frauenseilschaften lösen sich oft nach zwei, drei Jahren auf, während Männer kontinuierlich über Jahrzehnte zusammenhalten, und alles, was sie so kriegen und in ihren Einflussbereich einschieben können, untereinander aufteilen. Ich war in verschiedenen Netzwerken, aber es hat leider immer viel zu früh geendet.
Woran liegt das, denkst du? An höherem Druck?
Ja, das könnte schon sein. Diese Konkurrenz, man entwickelt gemeinsam was, und dann bekommt die eine eine Chance und nimmt alles, was man gemeinsam entwickelt hat, mit. Da gibt es weniger langfristiges Denken, dass man 20, 30 Jahre durchhält. Der Druck ist hoch, und das Geld fehlt. Mein Wunsch wäre eine Gesellschaft von Mäzeninnen, oder eben Frauen, die im Betrieb sind, mit genügend finanziellem Rückhalt, die andere Frauen fördern, damit die Konkurrenz nicht mehr so stark ist.
Meine Vermutung ist, dass es nicht daran liegt, dass Frauen Frauen sind, sondern dass Männerseilschaften auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen sind.
Ja, auch, dass Frauen im Schnitt existentiell schlechter dastehen. So wie soziale Klassen sich auch immer halten. Die Wahrscheinlichkeit, aus einer niedrigeren sozialen Klasse aufzusteigen, ist gering. Das greift ineinander. Da müsste es einen grundlegenden Schub zur Veränderung geben.
Aber ich hab schon den Eindruck, dass sich da was geändert hat, dass es zur Zeit sehr viele Initiativen und Versuche von Frauen gibt, das zu durchbrechen.
Ja, jetzt ist wieder eine gute Zeit. Eben Initiativen, wie euer Blog, die PS oder die Geschichte mit „Wir machen das“ oder „Weiterschreiben“. Aber so etwas wie „Wir machen das“, das sind ja schon mächtige Frauen.
Kannst du die Initiative kurz vorstellen?
„Wir machen das“ ist ein Zusammenschluss von über 100 Frauen, um etwas zu verändern, Frauen mehr in die Unis reinzubringen und so weiter. Das ist unter anderem auch aus dem Hochschuldiskurs um Sexismus entstanden. Die haben zum Beispiel das „10 nach 8“ Format bei der „Zeit“ initiiert, aber dafür haben sie auch echt stark gekämpft. Für mich geben die ein unglaublich positives Signal, wenn ich aus so einer Diskussion oder einem Panel herauskomme, fühle ich mich immer so: ja, so muss es sein! Das sind ja alles wahnsinnig interessante Frauen und da funktioniert die Solidarität.
Wenn man jetzt konsequent sein will und eben diese verschiedenen Diskriminierungsmechanismen durchbrechen will, sollten wir für eine Weile vielleicht ausschließlich lesbische Women of Colour veröffentlichen und lesen?
Nein, man muss sich ja nicht so reduzieren. Aber ich mache das seit sicher 20, 30 Jahren so. Nicht, dass ich nicht auch Männer lese, aber ich achte automatisch darauf, mehr Frauen zu lesen. Ich bemühe mich auch bei den Lesevorschlägen in meinen Kursen an den Unis mindestens die Hälfte Autorinnen, wenn nicht mehr, den Studierenden aufzugeben. Weil ich auch versuchen möchte den weiblichen Stimmen mehr Sichtbarkeit zu geben. Und das ist schon ungewöhnlich, weil die meisten anderen Dozierenden das einfach nicht machen. Ich mache das, weil ich schon ganz viele tolle Autorinnen gelesen habe und weiß, dass sie so viele Einblicke geben können und auch künstlerisch wahnsinnig viel zeigen können. Und darüber erzähle und spreche ich natürlich auch viel und gebe das so weiter. Wenn ich das nicht machen würde, würde das ja alles verloren gehen, das wäre schade.
Als ich in London studiert habe, hatte ich das Gefühl, dass da ganz selbstverständlich drauf geachtet wurde, dass Texte aus verschiedenen Kulturkreisen, Hintergründen und von Frauen und Männern gelesen wurden. Die Thematik der „Identity Politics“ war insgesamt in den Literaturseminaren viel präsenter. In München hingegen sind in den Leselisten kaum Frauen aufgetaucht, geschweige denn POCs.
Ja, da alleine ist schon so viel zu tun, jetzt, 2019. Als ich am Leipziger Literaturinstitut war, habe ich mich gerade deshalb auch so gut mit den Initiatorinnen der PS verstanden, weil die ja auch diesen Ansatz haben, den Hintergrund der jeweiligen Autorin, des jeweiligen Autors mit einzubeziehen. Ich war dort eine der wenigen Dozierenden, die versucht hat, immer auch Frauen oder Autor*innen zu besprechen, die einer Minderheit angehören. Darüber haben wir uns mit der PS-Redaktion verbunden gefühlt. Klar, wenn ich mal einen interessanten Autor kennenlerne, lese ich den schon. Ich habe 5 Jahre in den USA gelebt und da wird dir das zur Selbstverständlichkeit, ich finde das auch schön und das bereichert total, verschiedene Perspektiven zu lesen. Aber hier in Deutschland, gerade in so einer Jury, merkt man, dass es noch lange nicht selbstverständlich ist.
Ich finde das auch sehr wichtig, dass sich gesellschaftlich da ein Bewusstsein entwickelt, das zur Gewohnheit wird und ein Blick für solche Themen entsteht. Und du arbeitest ja durch solche Aktionen mit daran.
Ja und auf literarischer Ebene ist das auch wichtig. Ich nehme immer Frauen als Hauptfiguren, das mache ich bewusst, obwohl das nicht so gern gelesen wird, wie die Preisstatistiken zeigen.
Ja das ist dann anscheinend schon ein politischer Akt, seine Hauptfigur weiblich zu machen.
Ja, anscheinend (lacht). Es wird ja dann von vielen Leuten auch so abgewertet, also dann heißt es zum Beispiel über ein Buch, das ich geschrieben habe: „das ist doch banal, eine Frau auf der Suche nach sich selbst, über so eine Phase muss man doch mal hinweg sein“ und so weiter. Private Dinge sollen woanders verhandelt werden. Wenn ich dagegen einen tollen 60-jährigen Fotografen kreiere, der durch die Welt gereist ist, dann wird das gleich ernster genommen, weil es dieser männliche Typ ist, den ich darstelle.
Das ist sowie so auch nochmal ein spannendes Thema, wie wir Figuren darstellen, auch in Hinsicht auf andere Aspekte. Wie kann ich als weiße Autorin z.B. POC Perspektiven darstellen, ohne übergriffig zu werden und Rassismus zu reproduzieren?
Ich schreibe eigentlich immer über Menschen, die ich kenne oder die ich kennengelernt habe, die in meinem Leben irgendeine Rolle spielen. Dabei kommt man sich näher und ich versuche die Stimme der- oder desjenigen zu erfassen. Oft sind das nicht Autor*innen, sondern Leute, wie die Mutter einer Freundin meiner Tochter, die Rassismus nach der Wende erlebt hat, die mir diese Geschichte erzählt, die aber selbst die Geschichte nicht schreiben möchte oder kann. Ich würde mir niemals anmaßen, da wild irgendwas zu erfinden, sondern wenn ich das mache, dann immer, weil ich eine Nähe habe zu diesem Menschen und der muss natürlich auch einverstanden sein, dass ich das tue. Und ich versuche auch, den Prozess wie ich zu diesem Material komme mit darzustellen, also dass ich das Medium mit sichtbar mache, wenn es zum Beispiel eine Tonaufnahme ist, dass der Text auch sehr oral ist, um die Entstehungsweise deutlich zu machen.
Ja zum Beispiel bei deinem Buch „Das Gesetz des Dschungels“, hast du solche Verfahren angewandt.
Ja, aber das ist trotzdem schwierig, du musst die anderen mit einbeziehen und deine eigene Rolle auch immer mit reflektieren, anders würde es mir einfach komisch vorkommen.
Oder nach neuen erzählerischen Lösungen suchen. Was auch eine interessante Idee ist: Ich bin gerade sehr fasziniert von der amerikanischen Autorin Carmen Maria Machado, die so zwischen feministisch, queer und Fantasy schreibt. Es ist echt toll, wie sie das macht, wie sie diese Zuschreibungen von Frauenrollen seziert, aber gleichzeitig ins Unheimliche und Gespenstische hineinarbeitet. Wow!
Klingt super.
Ja. Also ich finde es großartig, dass sie eben eine neue Methode gefunden hat, wie man Geschlechterklischees dekonstruiert, sie macht wieder Stories draus, was ganz anders ist als z.B. bei Elfriede Jelinek, die ja vor allem über Sprache arbeitet. Aber wenn du andere Menschen mit einbeziehst, und deren Geschichten erzählst, musst du natürlich immer neu überlegen: wie kann ich das darstellen.
Ja und das macht eben, wie du schon sagst, neue Herangehensweisen und besondere Sensibilität nötig. Vielen Dank für das spannende Gespräch!
Wepsert bedankt sich auch bei der Redaktion der PS für das tolle Match :)