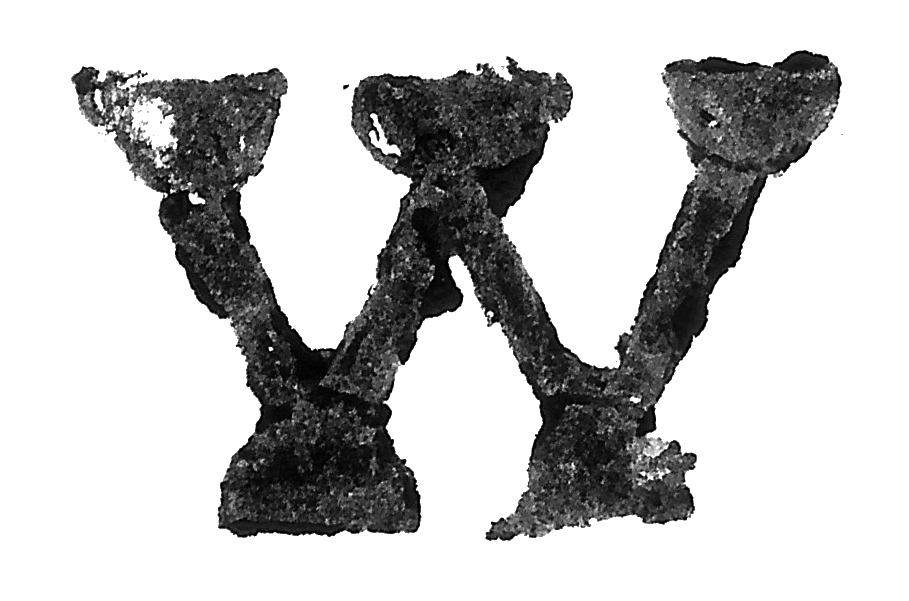Soft Spots
Härte und Weichheit, Kampflust und Sanftheit wurden in der Vergangenheit als typische Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen von Frauen und Männern angesehen. Was hat das mit unserer Erziehung und Sozialisation gemacht? Was macht das heute mit uns?
Feminismus heißt nicht, dass Frauen wie Männer werden sollen. Feminismus heißt auch nicht, Frauen als das per se friedlichere und bessere Geschlecht anzusehen. Dennoch gab und gibt es spezifische Erziehungskonzepte für Jungen und Mädchen. Und dennoch gibt es im praktischen Leben Gesprächs-, Lebensgestaltungs-, Karriere- und soziale Kulturen und Verhaltensweisen, die sich nicht gleichmäßig verteilen. In diesem schriftlichen Gespräch habe ich meine Redaktionskollegin Alisha Gamisch dazu eingeladen, auf meine Erinnerungen und Gedanken zu reagieren. Wir sammeln Überlegungen zum Erwachsenwerden und -sein im Hinblick auf Härte und Weichheit.
Als Mädchen großwerden
Heike: Die Mädchenerziehung, wie sie mir und meinen kleinen Freundinnen in den 80ern gedieh, war stark am Leitbild mutiger, starker Mädchen orientiert. Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf, die Rote Zora, rebellierende Prinzessinnen, Hexen, die fliegen und zaubern können. Einige dieser Rollenvorbilder tauchen auch noch in unserem Heldinnenquartett auf. Unsere Mütter wollten uns zu Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, lauter Stimme und scharfem Geist erziehen, denn mit uns würden die letzten Relikte des Patriarchats, das unsere Mütter an den Universitäten der 70er-Jahre bekämpft hatten, endgültig verschwinden. Soweit der Plan.
Alisha: Ja, die starken Heldinnen gab es in meiner Kindheit in den 90ern und 00er Jahren auch, aber ich erinnere mich trotzdem auch an ziemlich schlimme Frauenbilder in den Märchen, Sagen und auch modernen Geschichten, die ich gelesen habe. Schön, gehorsam, sexuell zurückhaltend und fürsorglich sein, das war schon noch im Großen und Ganzen das Ideal, das mir in vielen Geschichten vermittelt worden ist. Ich bin zum Beispiel vor Kurzem wieder auf einen Artikel gestoßen, der die krass reaktionären Rollenbilder und rassistischen Ansichten in TKKG aufzeigt. Auch einige Disney Filme sind unfassbar sexistisch. Das hat trotz teils auch positiver Beispiele noch stark auf mich eingewirkt. Aber stark sein war immerhin eine Möglichkeit, wenn auch keine Notwendigkeit für mich, weil ich schnell gemerkt habe, dass ich über die Süß-sein-Schiene oft schneller zu dem kam, was ich wollte.
Heike: Das ist ja spannend, denn für Disney-Filme gab es bei uns ein regelrechtes Verbot! Wir wurden in Selbstverteidigungskurse für Mädchen geschickt – das Angebot der Mädchenarbeit war in den 80ern neu und breit – in Mädchentheatergruppen, wir gingen zum Mädchentreff des lokalen Jugendtreffs. Alles, um uns zu fördern. Toben, wildes Spiel, sich schmutzig machen, die Knie aufschlagen – Dinge, die für unsere Mütter noch als unziemlich galten – waren erlaubt, geradezu erwünscht. Raufen mit Jungs, Anführer der Bande sein, Pläne schmieden und sich die Nachbarschaft erobern sind für uns ebenso selbstverständlich gewesen, wie für unsere kleinen Spielkameraden mit Y-Chromosom.
Alisha: Das ist großartig, dass das bei euch so selbstverständlich war. Ich hatte da verschiedene Phasen und hatte auch das Gefühl (vor allem in der frühen Kindheit) verschiedene Rollen ausprobieren zu können. Generell meine ich mich aber zu erinnern, schon einen gewissen Zwang von außen gespürt zu haben, was sich für ein Mädchen gehört und was eher nicht. Das war nicht immer so direkt, sondern eher subtil, z.B. wenn die Kindergärtnerin von mir enttäuscht war, weil ich zusammen mit den Jungs frech den Morgenkreis boykottiert habe. Das hat mir leid getan. Aber es zeigt auch, dass Frechsein von mir als Mädchen nicht erwartet und mir nicht zugetraut wurde. Und wenn ich „Mädchensachen“ gemacht habe, war das halt einfacher und wurde positiver gesehen. Vor allem erinnere ich mich sehr stark daran, immer als süß gelabelt zu werden. Auch wenn ich zwischendurch Tomboy-Phasen hatte, an dem Süß-Sein-Müssen hat das nichts geändert. Selbstverteidigungskurse habe ich mitgemacht, aber richtig identifiziert damit habe ich mich nicht. Das hat neben der positiven Wirkung auch den Beigeschmack bei mir hinterlassen, dass ich als Mädchen immer potenziell gefährdet bin, also auch eine Verortung als Opfer. Das ist laut Mithu M. Sanyal auch ein Problem unserer Gesellschaft. Sie schlägt zum Beispiel Konsens-Trainings für Jungs und Mädchen vor. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum für Jungs keine Notwendigkeit für Selbstverteidigungskurse gesehen wird.
Jungen und Mädchen sollen gleichberechtigt großwerden. Die Ansätze, das zu erreichen, haben sich über die Jahrzehnte stark geändert.
Heike: Ich habe mich bis zur Pubertät den Jungen eigentlich als gleichberechtigt empfunden. Mein Geschlecht war mir, von einem Basisinteresse an Geschlechtsorganen und einer grundsätzlich positiven Einstellung dazu abgesehen, auch ziemlich egal. Wichtiger war Klettern können, den Körper einsetzen, Lust am Lernen und an der Bewegung. Lust am Entdecken. Gender war mir eher wurscht.
Alisha: Ich weiß, dass ich mir meines Genders ziemlich früh bewusst war. Ich habe auch totale Klischeehobbys gehabt, orientiert an meiner großen Schwester: Ballett, Eiskunstlauf, Tanzen, Reiten. Bei mir hat die selbsterfüllende Prophezeihung voll gegriffen: Einmal wurde mir gesagt: Mädchen können nicht werfen, und dann war das halt so, das habe ich angenommen.
Heike: Trotzdem gab es natürlich Unterschiede. Unsere Mütter waren besonders bei uns Töchtern sehr besorgt, dass wir zu Opfern von Sexualdelikten werden. Zurecht, denn 75 % der Kinder, die Opfer sexuellen Missbrauchs werden, sind weiblich. Dieses von mir unterschwellig wahrgenommene Bedrohtsein, die Befürchtung Dritter, dass ich zum Opfer werden könnte – jetzt, wo du es ansprichst, ja, das wird schon da gewesen sein. Der fremde Mann im Auto, der mit der Carrera-Rennbahn oder den Meerschweinchenbabys bei sich zu Hause lockt, ist als Warnung allgegenwärtig gewesen. Wir waren genau instruiert, uns bei einer Gefahr dieser Art richtig zu verhalten – wir Mädchen sollten uns aber auch, im Gegensatz zu unseren Brüdern und Spielfreunden – nicht in unserer Rolle als weiblicher Teenager oder Frau ausprobieren, indem wir spielerisch flirten, posieren oder uns verkleiden, uns lustvoll verhalten und darstellen. Zu sehr haben unsere Mütter den Lolita-Effekt gefürchtet, zu groß war die Angst, dass ihre Töchter zu Opfern werden. Ich sollte also stark sein und mich wehren können.
Alisha: Das war bei mir anders, mich mit meinen Geschwistern und meinen Freundinnen zu schminken und zu verkleiden, Fotos zu machen war total selbstverständlich und auch Teil unserer Identitätsbildung. Ich bin auch schon mit 10 Jahren auf eine Kindergeburtstagsparty gegangen, wo wir alle stark geschminkt waren und Minirock und hohe Schuhe anhatten. Da spielt sicher auch eine Rolle, dass meine große Schwester ein schon reiferes Vorbild für mich war. Gleichzeitig fällt mir auf, was für einen hohen Stellenwert Aussehen hatte. Das kann auch sehr schnell von einer Selbstermächtigungs-Technik zu einem großen Unsicherheits- und Selbsthassfaktor werden.
Heike: Ich bin ein bisschen neidisch auf dein Ausprobieren von tussigen Looks. Das ist bei mir nur in sehr kleinem Umfang geschehen, und eher heimlich, weil es nicht so gerne gesehen war. Trotzdem habe ich immer gemerkt, dass mich das magisch anzieht, dass ich das auch will. Ebenso bei den sogenannten Talenten – sprachlich-musische Fächer – das hat mich bei meiner Beschäftigung mit der Thematik mit Anfang 20 geradezu gefuchst, dass ich da so dem Rollenbild folge, das man als typisch empfindet.
Toughness derzeit im Kino: Wonderwoman
Alisha: Ja das kann ich gut verstehen, dass du darin dann auch einen Reiz gesehen hast und dass dann irgendwann andererseits eine Irritation auftritt wenn bewusst wird, wie normiert die eigenen Interessen sind. Das Bewusstsein, dass bestimmte Interessen gendergeleitet waren, kam bei mir aber eben auch erst mit Anfang 20. Als Kind und Jugendliche habe ich schon versucht, die von mir als erwartet angenommene Mädchenrolle möglichst gut zu erfüllen. Das war auch nicht immer leicht. Schönschrift in der Grundschule war zum Beispiel eine Qual und ich war oft sehr unordentlich. Ich habe auch nie gefragt, ob ich nicht auch Teile von mir gar nicht kennenlernen konnte, weil ich sie nicht als für mich relevant wahrgenommen habe. Ich musste gar nicht so „stark“ sein, weil süß und diplomatisch sein eben oft besser geklappt hat. Das stimmt im Nachhinein natürlich nicht, denn wer weiß, was alles gegangen wäre, wenn ich meine „starke Seite“ mehr zugelassen hätte. Ich wusste zum Beispiel oft gar nicht, wie ich meine Gefühle ausdrücken sollte, wenn ich wütend war.
Heike: Wut konstruktiv ausdrücken, das ist vermutlich etwas, was man allen Kindern früh beibringen sollte! Ich denke, wir haben damals als Töchter für unsere genderbewussten Mütter kompensiert, wo sie unterdrückt wurden. Die Selbstverständlichkeit, mich als kleines Mädchen den kleinen Jungen gleichwertig fühlen zu dürfen, das ist durch nichts zu ersetzen und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ein Privileg, das vielen Mädchen heute noch nicht gewährt wird. Ich glaube aber, dass jede neu angestoßene Kompensation leicht in eine Überkompensation kippen kann, eine Verkehrung in ein dann wiederum nicht ausgewogenes Verhalten. Das wurde bei mir durch die Entwicklungen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter noch bestärkt.
Bolz- und Bierkumpels
Heike: Als Teenager in coole Kreise aufgenommen zu werden, hieß in meinem Fall, mit coolen Cliquen abzuhängen, die von coolen Jungs dominiert wurden. Grundsätzlich war schon mal alles cool, was "die Großen" gemacht haben, egal, ob große Jungs oder große Mädchen. Ältere Jungs, die man dank heterosexuellen Interesses für sich interessieren konnte, waren natürlich das Coolste vom Coolen. Ich war schon sehr darauf orientiert, von Jungen, sozusagen den damaligen Tonangebern, anerkannt zu werden.
Alisha: Nach deiner Definition war ich dann wohl ziemlich uncool! Die „coolen“ Jungs haben mir damals Angst gemacht. Ich hatte einen sehr innigen Freundinnenkreis, in dem wir uns ausprobiert haben. Und auch ziemlich abgekapselt. Da wurden wir schonmal als Lesben "beschimpft", weil wir so sehr für uns und liebevoll miteinander waren. Auch nochmal ein interessantes Thema, wie lesbische Frauen im Kontext von Härte und Weichheit gesehen werden und warum das schon von Jugendlichen als Beleidigung benutzt wird. Ich wollte trotzdem auch die Anerkennung von männlicher Seite. Da sind dann regelmäßig Lebenswelten aufeinandergetroffen, die nicht so viel miteinander zu tun hatten.
Heike: Wir haben das damals schnell hingekriegt, uns Respekt von den älteren Jungs zu verschaffen. Das war ganz einfach: Bier trinken und laut rülpsen, über's Wichsen reden können, dumme Witze und Sprüche machen, verbale Rangeleien nicht scheuen. Wie ein echter Kerl musste man sich benehmen, trotzdem Frau sein, wenn es um Liebe oder Sex geht. Aber unkompliziert bitte, wie der beste Kumpel. Keine Sissi. Kein Girly Girl. Für mich war das leicht, weil ich als Mädchen ja schon wild und frei gewesen war und sich das gut angefühlt hatte. Ich hab dann meine roughe Seite einfach beibehalten, der Feminine erst mal beiseite gelassen. Fand ich nicht so dramatisch.
Alisha: Ich finde es spannend, dass du die Verhaltensweisen der Jungs annehmen konntest und damit für sie interessant wurdest. Ich habe die entgegengesetzte Strategie gefahren. Ich war auf eine Art ein Girly Girl. Und auch eine Sissi. Rülpsen hätte ich mich nie getraut. Aber das sind natürlich total oberflächliche Bezeichnungen, die viele Ungereimtheiten ausklammern. Dadurch wurde ich ja auch Projektions- und Angriffsfläche für die Jungs, das typisch Andere. So richtig wohl in der Rolle hab ich mich dann auch nicht gefühlt. Ich dachte immer, wenn die Typen mich wirklich kennenlernen, wird das eine ziemliche Enttäuschung für sie. Ich wäre auch gern cooler, lässiger, kumpelhafter gewesen (krass, was cool und lässig offenbar für männlich konnotierte Wörter sind). Und das bewundert werden ging meistens damit einher, nicht ganz ernst genommen zu werden, sich absichtlich süß und etwas dümmlich zu machen, um bei den Jungs zu punkten. Oder sich rar zu machen, distanziert und bewundert zu bleiben. Das waren Härte- und Weichheitsstrategien, die sich innerhalb der damals für mich präsenten sozialen Normen umsetzen ließen. Nicht besonders viel Spielraum.
Softness auch auf dem Campus: Kenny aus dem Film A Single Man und sein Mohair-Pullover machen es stilsicher vor.
Die 20-er Jahre: Aneignungen
Heike: Bis weit in meine 20er-Jahre habe ich toughes Auftreten als Strategie behalten, mit gleichaltrigen Jungs bzw. Männern umzugehen. Auch in der Universität, in Seminaren zählte dickes Ego, dicke Hose, laut und dominant auftreten, bluffen. (Meine Philosophie studierenden Freundinnen erzählen mir bis heute Unfassbares über männliche vs. weibliche Redezeit in Seminaren, über Misogynie im Fach.) Mit einem starken Auftreten wie der bolzende Bierkumpel, nur eben mit Muschi, habe ich fast immer punkten können, und der Erfolg tat mir auch gut. Das ist total nachvollziehbar, mein Entgegenkommen hat auf männlicher Seite ja auch kein Umstellen auf eine vielleicht andere, nicht so vertraute Art erfordert, die ich mit Freundinnen in den WG-Zimmern durchaus ausgelebt habe.
Alisha: Haha, das stelle ich mir gerne vor, dich als bolzenden Bierkumpel, klingt sehr sympathisch. Bei mir hat in meiner Unizeit eine Politisierung angefangen, die mich einerseits für Machtungleichheiten sensibilisiert hat und gleichzeitig aus der Rolle des schüchternen Mädchens rausgeholt hat. Ich habe erst über den Ärger über all die Ungleichheiten gelernt, wie wichtig es ist, sich einzumischen, auch mal laut und egoistisch zu sein, sich zu behaupten. Das war und ist manchmal immer noch gar nicht so leicht für mich, es ist ja auch schmerzhaft sich von manchen internalisierten Eigenschaften und Selbstbildern zu lösen. Es bereichert aber so, das zu lernen!
Heike: Erst über Liebeleien und Lieben mit etwas Älteren habe ich mich dann als Fräulein entdeckt. Der antiquierte Begriff stand damals stellvertretend für mein Mich-Selbst-Entdecken als Femme. (Im Gegensatz zu Frau, als die ich mich seit Einsetzen meiner Regel irgendwie gefühlt habe.) Ich wurde galant behandelt, hofiert, umgarnt, bedient. Obwohl mir dabei klar war, dass das nicht ganz die Position ist, die ich für immer einnehmen will, habe ich das Spiel als Flirtritual sehr genossen. Nicht wettkämpfen müssen, nicht rangeln, in allen meinen Sensibilitäten gesehen und berücksichtigt werden, das war neu und angenehm. Feminin sein, inklusive einer roten Handtasche und eines ebenso roten Lippenstifts, das war befreiend und hat unglaublich Spaß gemacht, zog aber auch nach sich, nicht in allen Situationen für voll genommen zu werden. Vielleicht ist das meine erste bewusst wahrgenommene Diskriminierung gewesen? Jedenfalls habe in diesem Alter angefangen, mich stärker mit Feminismus auseinander zu setzen.
Alisha: Das finde ich wirklich erstaunlich, dass es da offenbar eine Relation gibt zwischen Sich- als-femme-geben und Nicht-ernst-genommen- bzw. Diskriminiert-werden. Bei mir gab es da wieder die entgegengesetzte Bewegung: Anfang 20 habe ich begonnen, genau dieses Verhalten abzubauen und meine nicht so „femininen“ Seiten auszuloten. Vor allem auch, von diesem pauschalen Süß- und Weichsein weg zu kommen. Endlich ernst genommen werden! Das war das Ziel. Und irgendwann dann zu akzeptieren, dass nicht alle dieser Eigenschaften, die ich als weiblich sozialisierter Mensch in mich aufgenommen habe, unbedingt abgelegt werden müssen, um emanzipiert zu sein. Es sollte doch darum gehen, Eigenschaften zu entgendern, also ihnen ihre geschlechtsspezifischen Zuschreibungen zu entziehen. Viel hilfreicher für unsere Gesellschaft wäre es zu fragen: Wie wollen wir sein, um einen guten Umgang miteinander zu ermöglichen und möglichst inklusiv zu sein? Und nicht: Wie sollte ich als Frau idealerweise sein oder wie sollte ich als Mann idealerweise sein? Das ist erstens ultrabinär und viel zu einfach, um komplexen Identitäten gerecht zu werden, und zweitens wäre es doch toll, wenn alle Menschen unabhängig von Geschlechterzuschreibungen danach streben würden, selbstbestimmte, selbstbewusste, reflektierte, empathische, in gutem Maß egoistische und altruistische, begehrenswerte und begehrende, emotionale und rationale Wesen zu sein.
Heike: Word.
Der versinnbildlichte weiche Unterbauch starker Frauen. Häufig gut versteckt.
Berufswelt und Sanftheit
Heike: Leben und Arbeiten im Status Quo unserer Arbeitswelt, für vornehmlich männliche Chefs, heißt vielfach immer noch, insbesondere die Skills zu entwickeln, die auch unsere Mütter schon in uns fördern wollten: Durchsetzungskraft, Initiative, Standhaftigkeit, Proaktivität, Dominanz, Selbstständigkeit, Kraft. Ich bin weit davon entfernt, solche Skills als besonders männlich zu bezeichnen, aber auffallend finde ich doch, dass genau die Charaktereigenschaften, die bei (einigen) linksalternativen Männern der 70er/80er en vogue waren (hier kam der Begriff des Softies auf) und die bei unseren Brüdern auch teilweise gestärkt werden sollten, nicht unter den gefragtesten oder von Erfolg gekrönten Strategien dabei sind. Wir sprechen von der Fähigkeit zur Selbstkritik, Weichheit, Empathie, einem Empfinden für das Wohl der Gruppe, Kompromissbereitschaft, Offenheit auch im Zeigen der eigenen Schwächen, Zuhören- und Sich-Zurücknehmen-Können. Eigenschaften, die man in der Vergangenheit als typisch weiblich angesehen hat.
Alisha: Ja, das ist wirklich problematisch, dass in dieser Gesellschaft rücksichtsloses, dominantes Verhalten, das bei Männern* häufig als Stärke missinterpretiert wird, oft zum Erfolg führt. Und das ist ist nicht mal nur auf die wirtschaftliche Arbeitswelt beschränkt. Selbst in einem Kindergarten bekommt oft die*derjenige die höhere Stelle, die*der sich am ehrgeizigsten und skrupellosesten in den Vordergrund drängt. Ich merke auch, dass ich oft Probleme mit älteren Männern in der Arbeit habe. Es wird besser, aber früher fiel es mir sehr schwer, in deren Gegenwart meine Meinung zu sagen und mich durchzusetzen. Dafür zu sorgen, dass ich ernst genommen werde eben. Und gleichzeitig bringt mich meine empathische Seite oft nicht nur nicht weiter, sondern schadet mir selbst sogar, z.B. wenn ich zu viel Verständnis für meine Chefin aufbringe und ihre Aufgaben mit übernehme, obwohl ich nicht dafür bezahlt werde. Wenn ich Kritik nicht ehrlich äußern kann, weil ich Angst habe, mein Gegenüber zu verletzen. Oder wenn ich über unflätiges Verhalten meines Chefs mir gegenüber hinwegsehe, weil ich weiß, dass er familiäre Probleme hat. Hier ist der Grad zwischen empathischem Verhalten und Unterwürfigkeit sehr schmal.
Heike: Dass Empathie und Umsorgen sehr schnell ausgenutzt werden kann, finde ich auch. Da bräuchte es Selbstdisziplin auf der Gegenseite, oder was macht man da? Nein-danke-sagen-Können. In den unterschiedlichsten Arbeitszusammenhängen nehme ich es so wahr, und ich bedauere das auch, dass wenn man nicht laut, dominant und mit dicker Hose auftritt, man sich nicht durchsetzen kann. Ebenfalls stelle ich fest, dass dann leisere Kolleg*innen verstummen. Dass sie nur noch etwas beitragen, wenn man sie blöd paternalistisch ermutigt. Zu oft – auch in Onlinediskursen, Podiumsdiskussionen usw. – gilt das Prinzip: Wer am lautesten ist, wird gehört. Wer sich die Redezeit nimmt, gibt den Ton an. Und ich mache da mit; das ist doch scheiße. Wie lassen sich solche Dynamiken regulieren?
Alisha: Puh, das ist schwierig. Es lässt sich wohl nie vermeiden, andere mal vor den Kopf zu stoßen. Grundsätzlich finde ich aber, dass der erste Schritt ist, sich selbst zu beobachten und zu realisieren, wie ich mich gerade verhalte. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich das jetzt ändern will. Zuhörenkönnen ist eine schwierig zu lernende, aber sicher sehr effektive Eigenschaft, um erfolgreich zusammen arbeiten zu können – und um sich mitzuteilen. "Mit dicker Hose" ist hier auch echt eine treffende Beschreibung, die deutlich macht, wie stark wir dieses Verhalten mit Männlichkeit verknüpfen. Umso bemerkenswerter, da es ja auch viele Männer gibt, die in diesem System total unglücklich sind und die sich auch kein Gehör verschaffen können, genau wie es viele Frauen gibt, die davon profitieren, besonders laut und dominant aufzutreten. Tendenziell ist es allerdings auch so, dass Frauen, die sich dominant verhalten, oft negativer bewertet werden, als dominante Männer, weil sie sich damit Rollenzuweisungen widersetzen. Ich glaube, ein guter Weg kann es sein, auf die Metaebene zu gehen. Machtdynamiken bewusst zu machen und anzusprechen. Das könnte schon einiges bewirken. Der Konflikt zwischen Empathisch- und gleichzeitig Erfolgreich-sein-Wollen lässt sich nur durch die Arbeit an sich selbst nicht lösen.
Heike: Sehe ich auch so, in gewisser Weise wieder ein Zeichen für eine Art von Weichsein, erst mal sich ändern zu wollen, den Fehler bei sich zu suchen und nicht im System. Ich merke, das ist komplex. Auch abseits beruflichen Auftretens bemerke ich, dass bei allem Stark-Sein-Wollen bestimmte Skills bei mir unterentwickelt sind. Ich freunde mich nur sehr zögerlich mit meiner eigenen Verwundbarkeit an, hätte diese Seite manchmal am liebsten gar nicht. Dann wieder lasse ich nicht locker beim Diskutieren und werde auch manchmal aggressiv, stecke gar nicht gerne zurück. Ähnliches erlebe ich bei Freundinnen und Bekannten, vor allem engagierten, selbstständigen. Man muss ihnen nie bei irgendwas helfen. Alles können sie alleine. Sie sind bereit, im Wettbewerb zu kämpfen und ihre ganze Kraft einzusetzen. Gewappnet ziehen sie in die Welt und konkurrieren, wo keine Konkurrenz herrschen müsste. Behaupten und verteidigen sich, ohne zu prüfen, ob es die Situation erfordert, leben in Rüstung. Werden durchaus auch high von Macht. Und da fehlt es dann wieder am Empathie.
Alisha: Gleichzeitig erlebe ich in meinem Freund*innenkreis, dass Frauen insbesondere in Beziehungen und Familien immer noch einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen. Mag ja sein, dass sie im Beruf kämpferisch sind. Aber wer spricht Probleme in Beziehungen an, wer analysiert, wie es besser gehen könnte, wer kümmert sich um die Kinder, um das Wohlbefinden aller Beteiligten, um das soziale Leben? Wer arbeitet in Kindergärten, Schulen, Altersheimen? Auch hier ändert sich viel. Aber es ist trotzdem noch auffällig, dass diese Tätigkeiten meistens von Frauen ausgeführt werden. Oftmals opfern sie sich auf, obwohl das weder ihnen noch anderen wirklich hilft. Das muss sich ändern. Und ich finde es extrem wichtig, sich im Jobbereich weder vom Konkurrenzdrang vereinnahmen, noch sich ausbeuten zu lassen. Sich lieber zu solidarisieren und gemeinsam und bestimmt Probleme mit Vorgesetzten anzusprechen. Sich gegenseitig zu stärken und Gegebenes nicht einfach als gegeben hinzunehmen.
Wer entlaust hier wen?
Discovering Soft Spots
Heike: "Stay soft" ermuntert das Missy Magazin und regt uns an, bei allem feministischen Kampfeswillen nicht zu vergessen, dass die besten Veränderungen die sind, die man nicht mit Gewalt bringt. Dass wir uns nicht in Alpha-Mädchen verwandeln müssen, die Beta-, Gamma- usw. Menschen dissen und unterdrücken. Dass wir überhaupt keine Rangordnung aufstellen müssen. Und dass Weichheit was Starkes und Schönes, Konstruktives sein kann. Das ist, was ich mit Überkompensation meine, durch unser Gespräch habe ich so den Eindruck, dass zwischen zwei Polen gependelt wird, die steinharte, dominante Berufsfrau und das fürsorgliche Märtyrer-Muttchen zuhause. Leider werden diese Fronten medial noch verstärkt, dabei wäre die Mitte das Richtige.
Alisha: So schwierig es auf der individuellen Ebene auch ist, sich zwischen dem Wunsch erfolgreich zu sein und dem Anspruch sozial und empathisch zu sein, zu verhalten, sollte Emotional Labor viel mehr gewertschätzt und gegebenenfalls auch bezahlt werden. Eine vom individuellen Austarieren von Stärke und Schwäche unabhängige gesellschaftliche Aufgabe. Und es gehört entgendert! Wir alle sind dafür verantwortlich, dass unsere Gesellschaft ein angenehmes Miteinander ermöglicht. Und wir sind alle vom Verständnis, der Empathie und der Fürsorge unserer Mitmenschen abhängig. Stärke muss nicht unbedingt auf Kosten anderer gehen, Coolness muss nicht ausgrenzen und Softness zuzulassen heißt auch, sich als vollständigen Menschen zu akzeptieren.