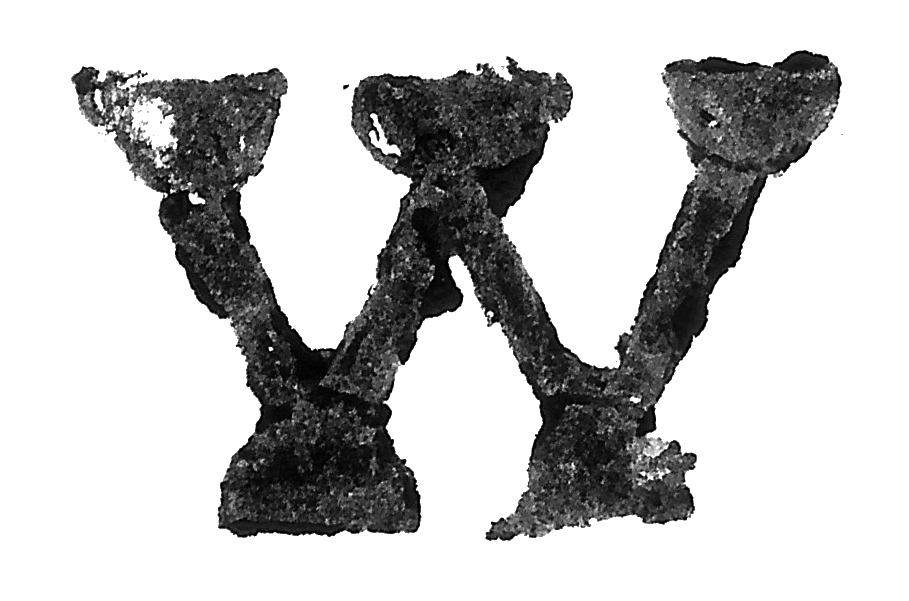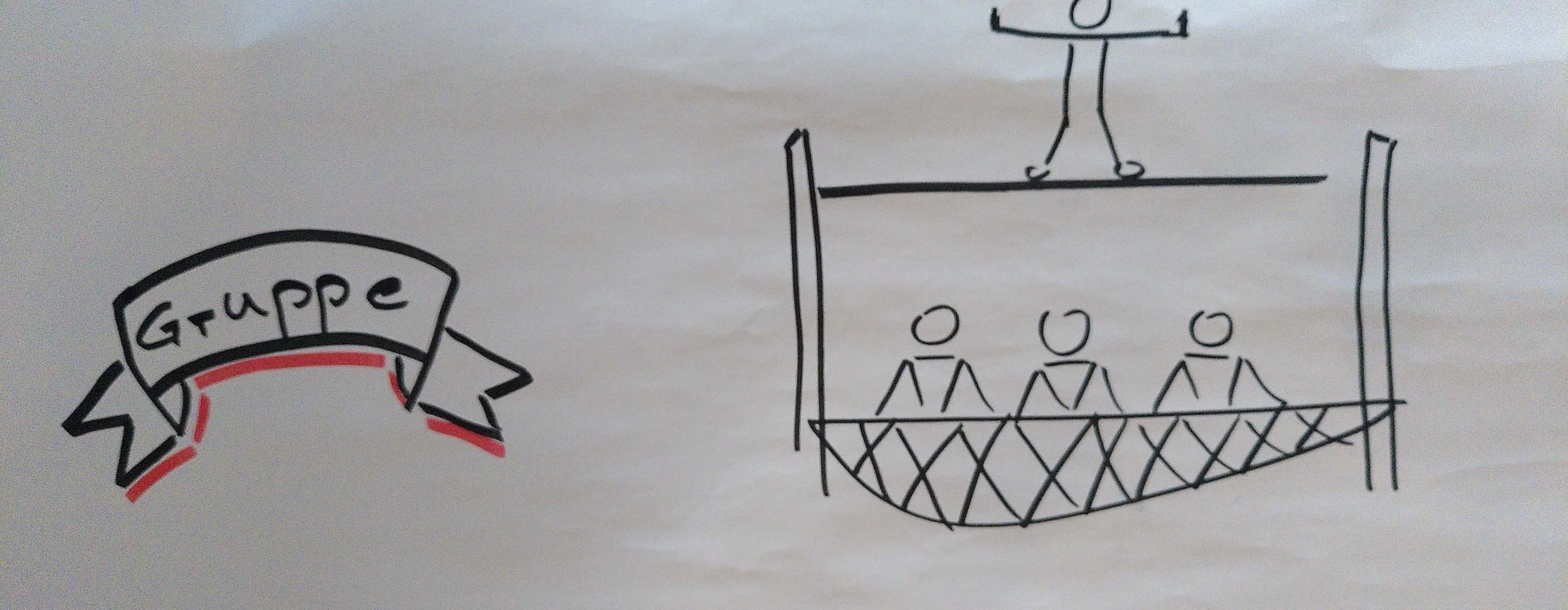Sich selbst und anderen zuhören – Von Schreibgruppen und dem Mut zu schreiben
Ich sitze im Schreibkurs. Wir sollen einen Text über unseren Namen schreiben. Ich bin sehr ehrlich, wenig literarisch. Gebe im Text viel von mir preis. Beispielsweise meine Sexualität, aber auch mein Verhältnis zu meiner Herkunftsfamilie. Nun sollen wir den Text vorlesen. Das kommt unerwartet, war nicht angekündigt. Ich zittere, mir wird schwindelig, beim Lesen bricht mir die Stimme weg. Im Nachhinein wundere ich mich über mich selbst. Doch in diesem Moment fühlt es sich nach einem Mehrfachouting an, dem ich nicht zugestimmt hatte. Natürlich, ich hätte mich weigern können vorzulesen. Doch der Gruppendruck ist hoch und die Selbstverständlichkeit der Gruppenleitung, dass wir unsere Texte vorlesen noch höher.
Ich schreibe. Meistens nur für mich. Weil es mir guttut, weil Schreiben mich sortiert, weil ich durch das Schreiben Dinge, die geschehen sind, durcharbeiten, verändern, begreifen kann. Ich schreibe Analysen auf und tagebuchartige Einträge, ich schreibe autobiographische und autobiographisch-fiktionalisierte (autofiktionale) Texte, Lyrik.
Wenn ich einen Blog-Artikel wie diesen hier schreibe, dann verändert sich etwas in mir und meinem Schreiben. Wenn ich einen Text in einer Schreibgruppe schreibe, einer Gruppe also, die sich dazu trifft, um Texte zu schreiben, vorzulesen und zu feedbacken, dann verändert auch das etwas in mir und meinem Schreiben. Mir ist dann bewusst, dass andere meine Worte hören oder lesen werden. Ich möchte, dass andere meine Worte hören oder lesen werden. Und dennoch habe ich auch Angst davor.
Früher, als ich noch als Wissenschaftlerin arbeitete, da habe ich mehrere dutzend Texte publiziert, mehrere dutzend Vorträge gehalten. Auch wenn es mir nie leichtfiel, Texte zu schreiben – ich neige dazu, endlos um Worte und Bilder zu kreisen – so gab es doch eine Legitimation für meine Texte. Und etwas, das mich vordergründig davor beschützte mit ihnen identifiziert zu werden. Als Kulturwissenschaftlerin ging es bei aller Selbstreflexion in meinem Schreiben nicht um mich – oder nur insofern als ich mich zum Instrument des Verstehens machte. Selbstverständlich gilt dies nicht für alle Wissenschaftler*innen und sämtliche Methoden. BIPoC z.B. genießen einerseits oftmals in der Wissenschaft nicht das Privileg des unmarkierten und unpositionierten Schreiben Dürfens. Autoethnographie, eine Mischung aus Autobiographie und Ethnographie macht z.B. andererseits die eigene Betroffenheit zum Ausgangspunkt der Analyse und damit des Schreibens.
Und nun? Nun habe ich meine Position als Wissenschaftlerin aufgegeben, ich publiziere nicht mehr in wissenschaftlichen Büchern oder Zeitschriften, sondern teile meine Texte im Freundeskreis, in meiner Studiengruppe und nun hier. Ich versuche dabei, aus meinen Erfahrungen heraus zu schreiben und statt Wissen Emotionen zu zentrieren. Das macht etwas mit mir. Der Wunsch, mich noch mehr mithilfe meiner Texte zu zeigen ist groß, die Angst ist es auch.
Ich bin eine weiße queere cis-Frau, Arbeiter_innenkind und krisenerfahrener Profi im sozialpsychiatrischen Bereich. Das bedeutet: viel eigene Therapieerfahrung und vor allem: einen Körper und eine Psyche, die nicht immer rund laufen, die an der Welt anecken. Das scheint in meinen Texten auf, wenn ich Abgründe und Erfahrungen erkunde. Am liebsten würde ich weiter intellektuell-abstrakte oder theoretische Texte über diese Erfahrungen schreiben. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, mutig zu sein und aus der eigenen Erfahrung heraus zu schreiben, die eigene Erfahrung schreibend zu teilen.
Meine anfangs geschilderte Erfahrung im Schreibkurs ist kein Einzelfall. Meine Angst, mein erfahrungsbasiertes Schreiben zu teilen kein individuelles Erleben. Wie kann dem begegnet werden? Wie können hemmende Erfahrungen verhindert und stattdessen Schreibkurse, Schreibgruppen kreiert werden, die Mut machen, die eigene Stimme zu erheben (Stichwort: Empowerment)?
© Maria Schmitter
Muträume kreieren
„I write because I’m scared of writing but I’m more scared of not writing“ schrieb Gloria Anzaldua 1981. Und zuvor: „I write to record what others erase when I speak, to rewrite the stories others have miswritten about me, about you. [...] To convince myself that I am worthy and that what I have to say is not a pile of shit. To show that I can and that I will write, never mind their admonitions to the contrary. And I will write about the unmentionables, never mind the outraged gasp of the censor and the audience“ (58).
Seit einem Jahr studiere ich wieder. Biographisches und kreatives Schreiben an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Ich werde zur Schreibpädagogin ausgebildet. Danach sollte ich wissen, wie das geht: zum Schreiben ermutigen, den Mut zu schreiben stärken. Was so einfach klingt, ist erwartungsgemäß viel komplexer. Denn Schreiben ist stets von Macht und Diskriminierung durchzogen. Für Menschen, die Diskriminierung erfahren, ist es oftmals gefährlich oder emotional geladen, die eigene authentische Stimme zu finden und diese hörbar zu machen. Zu oft wurde die eigene Schreib-Perspektive nicht verstanden, als zu extrem, zu individuell oder auch uninteressant abgewertet. Entsprechend beschreibt Felicia Rose Chavez in ihrem sehr zu empfehlenden Buch The Anti-Racist Writing Workshop: How To Decolonize the Creative Classroom, dass BiPoC oft eher vorsichtig auf die Einladung reagieren, in Gruppen zu schreiben und ihre Perspektive, ihre Stimme öffentlich zu teilen. „Nein, das ist nichts für mich!“, „Nein! Das mache ich nicht!“ heißt es dann. Die Erfahrung, dass es sicherer ist, nicht zu sprechen, sitzt tief. Und Chavez fährt fort: wenn sie einmal anfange, die eigene Perspektive zu zeigen und vertreten, dann könne sie oft nicht mehr aufhören. Auch das sei nicht immer angenehm.
Chavez plädiert deswegen dafür, bei empowernd gedachten Schreib-Workshops oder -Gruppen viele Gedanken und Mittel in die Rahmenbedingungen und die Gruppenbildung zu investieren. Z.B. dadurch, dass Selbst- und Gruppenfürsorge explizit Teil des Geschehens seien (z.B. durch Musik, das Mitbringen und Teilen von Essen und das Wahrnehmen der Stimmung der Anderen durch reflexive Anfangsrunden). Schreibgruppen müssen auch aktiv und explizit für diskriminierte Gruppen angeboten werden. Und das Vorlesen und Zuhören stehen im Vordergrund der Gruppen. Deep Listening nennt Chavez das. Durch das Vorlesen würde den internalisierten Stimmen im Kopf begegnet, die einer suggerieren, die eigene Stimme zähle nicht. Und es wird Verantwortung für das eigene Schreiben übernommen. Auch werden alle im Raum versammelten Stimmen damit gehört. Das trägt zur Anerkennungsgerechtigkeit und (kultureller) Sensibilität (Chavez 2021) in der Gruppe bei. Vorlesen und Zuhören. Dadurch kann ein ganz neuer Echoraum entstehen. Zu diesem kann auch die Auseinandersetzung mit Künstler:innen beitragen, die die Teilnehmenden inspirieren. Denn dadurch entsteht eine erweiterte Community der Worte.
Um einen sicheren Rahmen für alle Schreibenden zu kreieren, empfiehl Chavez auch, Feedbackgeben nochmals neu zu erlernen. Feedback solle einen selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Text ermöglichen. Z.B. durch Fragen, die zunächst auf den Schreibenden zentrieren, wie: was brauche ich gerade emotional? Und was brauche ich um MEINE Schreibziele besser zu erreichen? Erst wenn dies klar ist, wird Feedback gegeben. Damit wird zwischen einer Arbeit am Text und einer Arbeit am Selbst durch das Schreiben differenziert. Beides ist möglich. Beides ist hilfreich, doch es gilt zu unterscheiden; denn Feedback, das nicht gebraucht wird und für das mensch emotional gerade nicht bereit ist, kann auch nicht angenommen werden oder eine dazu bringen, künftig zu schweigen.
© Startup Stock Photos
Neue Erfahrungen ermöglichen
Das Schreiben in Schreibgruppen kann neue Erfahrungen ermöglichen. Die Erfahrung, dass die eigene Perspektive relevant ist z.B. oder, dass mensch damit gar nicht alleine dasteht. Um solche Erfahrungen zu ermöglichen, braucht es jedoch geschützte Räume, Safer Spaces. Die wichtigsten Elemente für diese im Rahmen von Schreibgruppen: Community ist Key – Gruppenbildung ist wichtig! Emotionen, Körper und Sinne werden zentriert und: Deep Listening. Wer weiterlesen möchte, der ist das Buch von Chavez zu empfehlen, aber auch der Klassiker von Frigga Haug zur Erinnerungsarbeit. Wer Erfahrungen in community-basierten Schreibworkshops machen will, der seien die Wepsert Schreibworkshops empfohlen.
Schreiben bedeutet für mich meine Handlungsfähigkeit und mein Menschsein zu spüren und auszudrücken. Schreiben ist für mich ein Prozess, durch den ich ganz bei mir bin und durch den ich zugleich auch ganz in der Welt bin. Durch das Schreiben kann ich meine Erfahrungen und Gedanken anschlussfähig und verfügbar für andere machen, mich in die Welt einschreiben, mir (m)eine Welt erschreiben, meine Perspektive auf die Welt ausdrücken, und Teil eines kollektiven Referenzstroms aus Worten werden. Wenn ich schreibe, bin ich zugleich in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
(Dies schreibe ich in einem Text über das Schreiben 2023).