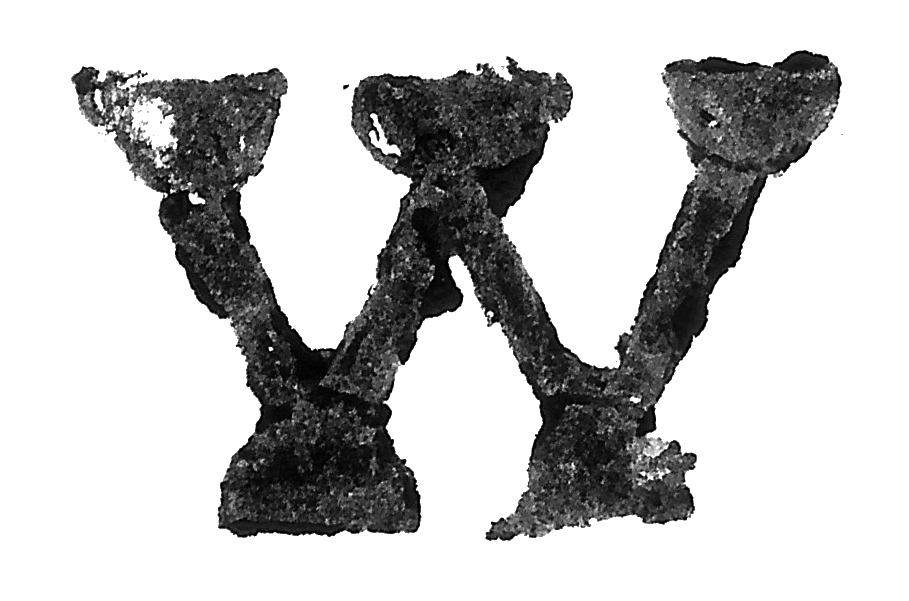Popsofa: "Making the Cut" - Othering in Heidi Klums neuem Format
Erstmal muss ich ein Geständnis machen: Ich finde Heidi Klums amerikanische Show „Project Runway“ äußerst unterhaltsam und auch Netflixs Format „Next in Fashion“ mit Tan France aus „Queer Eye“ habe ich gebinged. Ich war deswegen auch ein bisschen vorfreudig aufgeregt, was „Making the Cut“ angeht, eine Art Nachfolgeformat von „Project Runway“ mit Heidi Klum und Tim Gunn, das aktuell auf Amazon Prime läuft.
(Keine Angst, es gibt keine Spoiler.)
Schon seit einiger Zeit werben Heidi Klum und Amazon Prime mit ihrer neuen Sendung. Ein Wettbewerb für aufstrebende Designer*innen, genau wie „Project Runway“, aber diesmal „mit Designern aus aller Welt“, wie Tim Gunn in der ersten Minute der ersten Folge stolz erzählt. Die Sendung vermarktet sich selbst als global. Gesucht wird, so heißt es im Trailer „the next big global brand“.
Amazon, gleichzeitig Produzent und Produktplatzierung, macht dies möglich: Das Format ist auf der ganzen Welt zu sehen, die winning Looks jeder Challenge gibt es exklusiv bei Amazon zu kaufen, was eben auch weltweit bedeutet. Beim Zusehen wird klar, dass sowohl Format als auch produzierte Mode wohl doch nur für die westliche Welt gedacht sind.
Quelle: Heide Klums Instagram-Account
Ich war sehr enttäuscht und auch ehrlich gesagt ziemlich verärgert, als ich in der ersten Folge feststellen musste, dass „aus aller Welt“ für die Produzent*innen offenbar bedeutet: aus Westeuropa und den USA. Hauptsächlich. Eine Modedesignerin ist aus Südkorea, aber in den USA aufgewachsen. Eine andere Kandidatin stammt aus Isreal. Fast schon überflüssig zu erwähnen, dass auch in der Jury nur Angehörige westlicher Industrieländer sitzen.
(Was habe ich eigentlich erwartet? Zumindest Quotenvertreter*innen aus Südamerika, Afrika und Asien? Wäre das besser gewesen?)
“Making the Cut ist leider alles andere als ein weltweites Format.”
Ich habe beschlossen, die Show für das zu akzeptieren, was sie ist: „Project Runway“ plus westeuropäische Designer*innen. Aber nach ein paar Folgen sind die Kandidat*innen von Paris nach Tokio gereist und das „globale“ Format wurde derart ad absurdum geführt, dass ich nun darüber schreiben muss: Denn die japanische Kultur wird „ge-othered“, also als das Fremde, das Andere, das „Exotische“ dargestellt, und appropriiert, dass es meiner Meinung nach rassistische Züge bekommt.
Vorab muss ich einige Bemerkungen loswerden, zu diesen Designshows insgesamt. Positiv ist anzumerken, dass Homosexualität überwiegend zur Normalität gehört. Will heißen: Wenn ein Designer schwul ist, wird es nicht verschwiegen, aber auch nicht mit viel Drama thematisiert.
Im neuen Format „Making the Cut“ bemühen sich auch sehr viele Designer*innen um Genderfluidität und Genderneutralität ihrer Kreationen – ist vielleicht einem Trend geschuldet, aber auch ein Trend darf ja mal positiv sein. In den letzten Jahren war auch immer wieder Size, Körpermaße bei den Models, ein Thema. Es gibt in jeder Sendung auch „Plus-Size-Models“ und die Juror*innen betonen regelmäßig, dass Mode zu jeder Körperform passen muss. Die überwiegende Mehrheit der Models ist immer noch über die Maßen schlank und auch „Plus-Size“-Maße haben wenig mit realen Körpern von Frauen zu tun.
“Wertschätzung, Gender- und (theoretische) Körpervielfalt gibt es als Pluspunkte zu vermerken.”
Auch beobachte ich freudig den Trend, dass in „Next in Fashion“ und auch bei „Making the Cut“ Konflikte zwischen den Kandidat*innen nicht mehr als bitterböses Drama inszeniert und geschürt werden. Es gibt Konflikte und sie sind immer noch Teil des Narrativs einer Folge, aber die Kandidat*innen werden als mündige und professionelle Erwachsene dargestellt, die sich mögen, ihre Konflikte lösen und miteinander arbeiten können. Vor allem Netflix’ „Next in Fashion“ erzeugt eine absolute Wohlfühlatomosphäre, in der die Designer*innen sich gegenseitig wertschätzen und auch von der Jury gewertschätzt werden. Kritik an ihren Kreationen wird hier behutsam und konstruktiv geäußert. Nichts ist zu spüren von der Dieter-Bohlen-Simon-Cowell-Manier, die Kandidat*innen mit semi-witzigen Vergleichen fertigzumachen. Das wurde auch in „Project Runway“ so praktiziert.
Bei „Making the Cut“ gibt es teilweise verletzende und verurteilende Kritiken, ich habe aber den Eindruck, dass die Jury von Folge zu Folge behutsamer mit den Werken der Modeschöpfer*innen umgeht. Vor allem merkt man das bei der Kritik von Dauerjurorin Naomi Campbell, die sich von fieser Icequeen zur sentimentalen und stolzen Mentorin mausert. Die Kandidat*innen sind hier auch explizit aufgefordert, zu der Kritik Stellung zu beziehen. Sie müssen nicht wie verschreckte Kinder das Donnerwetter abwarten. Jeder Mucks von ihnen wird in „Project Runway“ als Widerrede gescholten. Bei „Making the Cut“ dagegen werden die Äußerungen der Kandidat*innen zu ihren Kreationen in die Bewertung aufgenommen. Es wundert mich stark, dass in den Trailern gerade mit den richtig abschätzigen Kommentaren der Jury geworben wird. Das hat die Sendung meiner Meinung nach nicht nötig und wird ihr auch nicht gerecht.
Diese Entwicklung weg von Formaten, die nur auf Drama und Konflikte setzen, finde ich grundsätzlich gut.
Zurück zum eigentlichen Thema: Wir reisen also zusammen mit den Kandidat*innen, Heidi Klum und Tim Gunn nach Tokio. Tokio wird dabei zumindest in unterschiedlichen Facetten repräsentiert. In jeder Challenge geht es um einen anderen Aspekt, um einen anderen Stadtteil von Tokio. Es geht viel um Street Wear und Technik – vielleicht ein Versuch von der Marke Amazon, sich als cool und innovativ zu präsentieren.
Hauptsächlich ist Tokio aber eins: das exotische andere, das von den Kandidat*innen und auch von Heidi und Tim neugierig und bewundernd beäugt wird. In jeder Folge gibt es kleine Mini-Episoden, was Heidi und Tim so erleben. In einer Folge bestaunen sie „exotische“ Lebensmittel auf einem Markt, natürlich Früchte und Fisch; in einer Folge spielen sie ein Virtual-Reality-Computerspiel; in einer Folge trinken sie Sake und lassen sich vom Kellner Japanisch beibringen.
In einer der ersten Folgen, die noch in Paris spielt, lassen Heidi und Tim von einem französischen Straßenkünstler Karikaturen anfertigen. Zugegeben auch etwas stereotyp, aber es fällt doch auf, dass der Blick hier zurück geht: Der Karikaturist blickt auf Heidi und Tim und drückt seine Sicht in einem Bild aus. Die Japaner*innen, die vorkommen, werden nur in den Blick genommen, ihre Sicht der Dinge wird nie thematisiert.
“Japaner*innen kommen in der Sendung niemals zu Wort.”
Japaner*innen kommen nur als Statist*innen vor. Sie sind Kellner*innen oder Fremdenführer*innen, im Hintergrund begleiten sie die westlichen Protagonist*innen bei ihrer Begegnung mit der „fremden Kultur“. Sie haben aber niemals Einfluss in der Sendung und kommen nie zu Wort.
Ein Beispiel sind die Näherinnen. In einer der Challenges bekommen die Designer*innen jeweils ein Team von drei Näherinnen zur Seite gestellt, das sie anweisen müssen. Die Näherinnen sind allesamt japanische Frauen, die kein Englisch sprechen. Verständigung funktioniert über Übersetzerinnen. Die Designer*innen werden von Tim Gunn über die Näherinnen befragt, umgekehrt dürfen sich die Näherinnen nicht über ihre Chefs äußern.
Die Tatsache, dass westliche Designer*innen asiatische Näherinnen einstellen, um ihre Arbeit zu erledigen, ist vielleicht realistisch, aber, wie ich meine, unglücklich gelöst. Hier hat das Format, das sich durchaus auch mit Stress und Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie beschäftigt, eine Chance verpasst. Die Chance auf einen Austausch über das Machtgefälle zwischen dem globalen Westen und Osten, das auch und gerade in der Modebranche existiert.
Vielleicht hätte der Austausch auch gar nicht so große Themen anschneiden müssen. Gereicht hätte es, die Perspektive der Näherinnen mit in die Sendung aufzunehmen.
Die Auswahl der Näherinnen hätte auch nicht allzu stereotyp ausfallen müssen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es in ganz Tokio keine englisch-sprechenden Japaner*innen gibt, die die Kunst des Nähens beherrschen. Und statt mittelalter Frauen hätten es ja auch ganz unterschiedliche Menschen sein können, um dem Klischee der asiatischen Näherin entgegenzuwirken.
In der selben Folge beschließt einer der Modedesigner einen „skinny Japanese boy“ bei der Modenschau in ein Kleid zu stecken. Er möchte damit Gendergrenzen in der Mode auflösen, ein Anliegen, das ehrenwert ist. Allerdings ist die Umsetzung meiner Ansicht nach rassistisch, denn er bedient sich rassistischen Vorstellungen von angeblich „nicht-männlichen“ asiatischen Männern. Das zeigt sich schon darin, dass er das männliche Model als „boy“ bezeichnet.
Ein weiteres Handling der japanischen Kultur, das mir aufstößt, ist die kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung (Cultural Appropriation) bedeutet, dass sich dominante/privilegierte Gruppen oder Personen kulturelle Symbole, Gegenstände oder Praktiken von subalternen/marginalisierten Gruppen abschauen, aneignen und einverleiben. (Definition aus diesem Artikel von Noa Ha.)
Kulturelle Aneignung gibt es in sehr vielen Bereichen, zum Beispiel in Museen, aber auch und gerade in der Modewelt. (Zum Beispiel indianische Kopfbedeckungen bei der Fusion, eine Debatte von 2016) Und es gibt kulturelle Aneignung auch bei „Making the Cut“. Ohne, dass es durch die Challenges vorgegeben ist, inkorporieren die Designer*innen japanische traditionelle Kleidung in ihre Designs – und sind damit nicht mal besonders innovativ oder einfallsreich. Kimonos gelten ohnehin seit ein paar Jahren als trndig und sind längst in der Modewelt angekommen. Und in Tokio einen Kimono zu entwerfen ist ungefähr so als würde man nach München reisen und dann nur Dirndl schneidern.
Hier wird nur ein Teil der japanischen Kultur genommen, ohne dass dies kritisch hinterfragt oder überhaupt thematisiert wird. An einer Stelle lobt die Jury sogar, dass man den japanischen Einfluss bei den Designs erkennt. Da kann man beim Zuschauen nur wütend den Kopf schütteln. Es wäre wichtig, dass es in so einem Format eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema gibt.
“Das Format hinterfragt seine kulturelle Aneignung nicht.”
Die japanische Kultur ist in dem Format nur eins: das Fremde. Das fällt besonders auf, weil die Modedesigner*innen nie auf kulturelle Unterschiede reduziert werden. Sie gehören zur westlichen Welt, man muss nicht bewundernd-erstaunt ihre Andersartigkeit feststellen.
Es ist schade, dass eine Sendung, die sich damit rühmt international zu sein, so sehr aus einer westlichen Perspektive heraus spricht und erzählt und nicht einmal thematisiert, dass sie dies tut. Die westliche Welt ist einfach der unmarkierte Normalfall.
Es hat keine verheerenden Folgen. Es gibt, wie gesagt, einige Facetten, und Tokio wird als Stadt dargestellt, in der man gerne leben möchte. Aber es gibt eben keinen Austausch von Perspektiven auf Augenhöhe. Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, dass eine Sendung zwar damit werben kann und behaupten kann ein „weltweites Format“ zu sein, es aber noch lange nicht heißt, dass sie divers oder weltweit ist, nur weil sie in Tokio spielt.