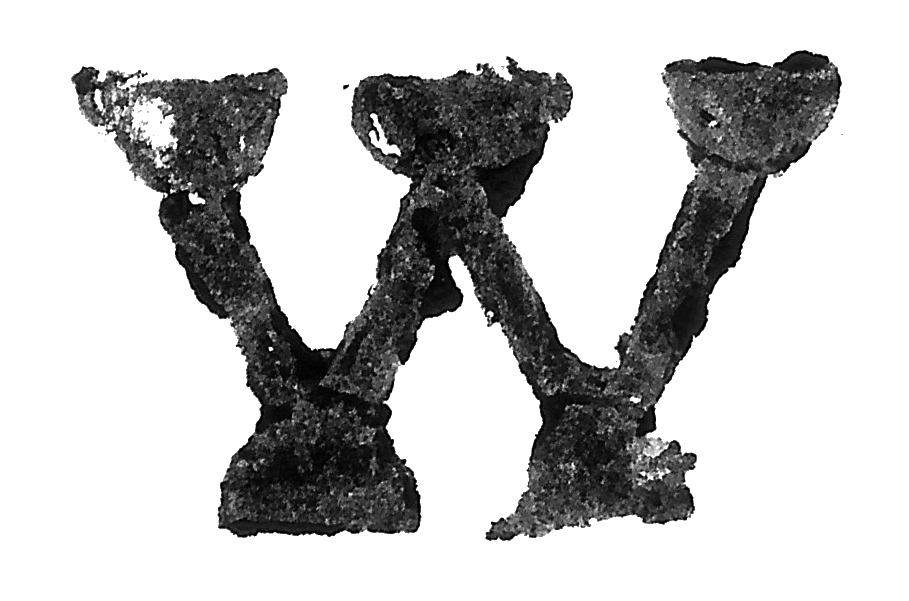Was passierte, als ich das sexistische Verhalten meines Kollegen meldete
Uli und #ichauch: Ein leicht deprimierender Bericht darüber, was passierte, als ich das sexistische Verhalten meines Kollegen gemeldet habe
JANUAR 2018: Erster Tag im neuen Job, ich bin glücklich. Nettes Team, spannende Aufgaben. Ich arbeite in einer Branche, in der über 90 % Männer arbeiten. Frauen in Führungspositionen sind hier die Ausnahme. Auch mein neues Team spiegelt diese traurige Realität wider, denn es besteht nur aus Männern, die alle deutlich mehr verdienen als ich. Und das, obwohl ich den höchsten Uniabschluss habe. Tja. Mein Vertrag ist auf ein halbes Jahr befristet. Von Anfang an heißt es: Wenn du dich reinhängst, kannst du bleiben. Also hänge ich mich rein. Ich arbeite hauptsächlich mit einem bestimmten Kollegen, nennen wir ihn Uli. Uli sieht aus wie ein Tagesschausprecher circa 1983, ist geschieden und besucht an den Wochenenden seine Mama. Irgendwie tut er mit leid. Uli könnte vom Alter her mein Papa sein und behandelt mich auch so. Gut, denke ich, er kann mir bestimmt etwas beibringen, eine Art Mentor werden. Doch schon in den ersten Wochen merke ich, dass er gerne alle unangenehmen Aufgaben auf mich abschiebt: Akten holen, Kaffee kochen, unangenehme Klienten anrufen. Denkt er, ich bin seine Sekretärin? Uli nimmt mich nicht unter seine Fittiche, Uli nimmt mich in den Schwitzkasten.
“So ist er halt. Mach dir nichts draus. ”
FEBRUAR: Auf dem Tisch liegt das SZ-Magazin, das Titelbild zeigt eine Frau im Hijab. Uli schüttelt den Kopf und wirft das Magazin in den Mülleimer. „Das ich sowas auch noch auf der Arbeit sehen muss.“ Mein Kollege Harald und ich wechseln einen Blick. Danach nimmt er mich im Flur zur Seite: „So ist er halt, der Uli. Mach dir nichts draus.“
MÄRZ: Ein paar Wochen später ist Weltfrauentag. Uli erklärt lautstark: „Das braucht doch kein Mensch.“ Keiner der Kollegen sagt was. Schließlich sind sie ja nicht gemeint.
APRIL: Uli nimmt mich gerne auf Veranstaltungen mit, allerdings frage ich mich oft, wozu eigentlich – Job-Escort? Arm Candy? Wenn es um Fachliches geht, wenden sich die Männer ausschließlich an Uli, der mich als seine Assistentin vorstellt, was weder meinem offiziellen Titel noch dem Inhalt meiner Arbeit entspricht. Visitenkarten werden getauscht, ich werde ignoriert, höchstens mal gefragt, wo ich gerne Urlaub mache. Einmal sind eine junge Bankerin und ich die einzigen Frauen im Raum. Der Fotograf bittet uns, für ein Foto mit einer Gruppe Männer zu posieren: „Was Hübsches in die Mitte!“
MAI: In einer Videokonferenz sitzt eine Kollegin in meinem Alter, die offensichtlich nicht Ulis Schönheitsideal entspricht: „So ein hässliches Weibsbild“, beschwert er sich danach. Überhaupt, die Kolleginnen. Uli lässt an keiner ein gutes Haar: zu hässlich, zu fett, zu alt findet er sie. Die eine ist eine „dumme Hausfrau“, die andere eine „blöde Kuh“. Er verzieht das Gesicht. Ich protestiere schwach: „Aber Uli, das kannst du doch nicht sagen!“ Ich klinge wie eine entrüstete Gouvernante, die einen Dreijährigen schimpft. Mehr traue ich mich nicht. Habe ich Angst vor Uli? Ein bisschen schon. Es ist die Angst, früher oder später in sein Visier zu geraten. Noch bin ich Ulis gutes Mädchen, das alles mit Humor nimmt, nichts falsch versteht, macht, was man ihr sagt, und ansonsten die Klappe hält. Der Preis dafür ist hoch. Ich komme jeden Tag fix und fertig aus der Arbeit, sage Verabredungen mit Freunden ab. Ständig habe ich Kopfweh.
“Der ist ja ein bisschen schwierig, sagt er. Er lacht.
Ich habe verstanden. ”
JUNI: Mein Vertrag wird verlängert. Aber erstmal nur um drei Monate. Der Teamchef sagt: „Streng dich weiter so an, dann können wir daraus vielleicht eine volle Stelle machen.“ Und: „Du passt super in das Team. Und klasse, dass du so gut mit Uli klar kommst, der ist ja ein bisschen schwierig.“ Er lacht. Ich habe verstanden. Also arbeite ich weiter und tue so, als ob nichts wäre. Und vielleicht ist ja auch gar nichts. Der Uli ist halt aus einer anderen Generation, er meint das bestimmt nicht so. Vielleicht ist er nur verbittert wegen seiner Scheidung. Ich finde eine Ausrede nach der anderen für Uli. Dabei ist die Wahrheit ganz einfach: Uli ist ein sexistisches Arschloch. Punkt. Ein paar Mal bin ich kurz davor, dem Teamchef alles zu erzählen, aber dann kommt wieder dieses beschissene Mitleid: Was passiert Uli, wenn ich was sage? Er ist doch schon über 50; wenn er rausgeworfen wird, findet vielleicht nie wieder einen Job. Und so weiter.
JULI: Uli und ich gehen fast jeden Tag gemeinsam Mittag essen, obwohl ich gar keine Lust dazu habe. Da ist es wieder, das Mitleid. Armer Uli, keiner will mit ihm essen gehen. Er hält Monologe über Frauen, Muslime, „Linke“. Statt ihm zu widersprechen, schweige ich und stochere mit gesenktem Blick in meinem Essen. Noch immer weiß ich nicht, ob ich meine Stelle behalten kann. Also nehme ich die Überstunden in Kauf, sage ja zu jeder neuen Aufgabe und tue so, als ob mich Ulis Ansichten kalt lassen, was mir immer schwerer fällt. Meine Hände fühlen sich taub an, mein Herz rast. Immer häufiger habe ich Migräne.
Ich zähle die Tage bis zu Ulis Urlaub, damit ich ihn endlich nicht mehr sehen muss. Wenigstens für zwei Wochen. Während er weg ist, treffe ich mich mit einem potentiellen neuen Klienten. Das Gespräch läuft extrem gut, der Teamchef lobt mich und erklärt, dass ich von jetzt an alleine verantwortlich für den Kunden bin. „Was ist mit Uli?“, frage ich. Mein Chef zuckt die Schultern. „Mir doch egal.“
AUGUST: Uli kommt aus dem Urlaub zurück, er ist schlecht drauf. Uli braucht eine bestimmte Akte und fragt mich allen Ernstes, ob ich sie ihm aus dem Archiv aus dem Keller hole. Zum ersten Mal sage ich Nein. Eine Mini-Rebellion, die sich Uli nicht gefallen lässt: statt selber in den Keller zu gehen, schickt er eine Praktikantin. Es geht ums Prinzip. Dann erzähle ich ihm von dem neuen Klienten. Das bringt das Fass an diesem Morgen schließlich zum Überlaufen: Uli rennt türenknallend zum Teamchef und beschwert sich so laut, dass ich es durch die Glastür hören kann, dass er nicht genug Autorität über mich hat und was ich mir einbilde, seine Klienten zu stehlen.
Jetzt, nach sechs Monaten, fragt mich mein Chef zum ersten Mal, was los ist. Ich erzähle ihm von den Kommentaren und Vorfällen der letzten Monate. Ihm tut es leid, das merke ich. Er fragt mich, ob ich ein Protokoll geführt habe. Habe ich natürlich nicht. Schon in den ersten Sekunden kippt das Gespräch, und ich merke, wie ich komplett die Kontrolle über die Situation verliere. Ich werde nach konkreten Situationen gefragt, nach dem wann, wo, wie. Obwohl wir alle im selben Büro sitzen, haben meine Kollegen offensichtlich nie etwas mitgekriegt. Die Beweislast liegt allein bei mir. Plötzlich bekomme ich Angst, dass mir niemand glaubt, dass ich mir alles nur eingebildet habe, dass ich vielleicht meinen Arbeitsstress auf Uli projiziert habe.
Mein Chef fragt mich, was ich will. „Dass er damit aufhört. Dass er sich entschuldigt“, antworte ich. Und dass er rausgeworfen wird, hoffe ich. Als ob er meinen Gedanken erraten hat, sagt mein Chef: „Du musst ihm die Chance geben, sein Verhalten zu ändern, wir können ihn nicht einfach kündigen.“ Ich kann mir nicht vorstellen, wie Uli und ich je wieder zusammenarbeiten sollen.
“Ich habe doch nicht dich damit gemeint, wieso regst du dich auf?”
Es ist Urlaubszeit, keine meiner wenigen weiblichen Kolleginnen ist im Büro. Also führe ich ein Gespräch über Ulis sexistisches Verhalten mit drei Männern. Vor Beginn des Gesprächs werde ich gebeten, doch bitte sachlich zu bleiben und nicht zu emotional zu werden. Wir sitzen an einem runden Tisch. Ich fühle mich wie auf der Anklagebank, alleingelassen, extrem verunsichert. Hoffentlich war das kein Fehler, denke ich die ganze Zeit. Uli wiederholt ununterbrochen, dass er meine „Meinung“ nicht akzeptiert. Dabei zittert seine Stimme vor Wut. Niemand ermahnt ihn, sachlich zu bleiben. Ich würde am liebsten weglaufen. Großzügig meint Uli: „Ich finde, du machst doch einen tollen Job.“ „Uli, es geht doch nicht darum, ob ich einen guten Job mache!“ Als ich die Kommentare über Kolleginnen anspreche, schaut er nur verständnislos: „Ich habe doch nicht dich damit gemeint, wieso regst du dich auf?“ „Wenn du schlecht über Frauen redest, dann meinst du doch immer auch mich. Ich bin schließlich auch eine Frau.“ Immer wieder bitte ich in dem Gespräch um sein Verständnis, versuche ihm verzweifelt zu erklären, wieso sein Verhalten scheiße ist. Irgendwann weine ich. „Uli, hast du den Eindruck, dass das alles ein Spaß für mich ist? Ich habe jeden Tag Kopfweh, kann nicht mehr schlafen, weil mich das hier so belastet.“ „Bitte bleib sachlich“, wiederholt mein Chef. Was besseres fällt ihm in diesem Gespräch nicht ein. Uli kuckt zum ersten Mal ein klein wenig betroffen. „Das wollte ich natürlich nicht.“ Es wird die einzige Entschuldigung bleiben, die ich von ihm bekommen werde. Wie zwei Kindergartenkinder müssen wir uns nach dem Gespräch die Hand geben. Ich habe wieder schrecklich Migräne und gehe nach Hause. Mein Chef geht am selben Abend mit Uli ein Bier trinken. Anscheinend ist jetzt alles wieder gut. Schwamm drüber, prost! Ich bin den Rest der Woche krankgeschrieben. Es folgt dann auch keine formelle Abmahnung, sondern lediglich Ulis Versprechen, sich zu bessern. Damit habe ich mich zu begnügen.
“Ich merke, dass die Männer in der Firma erleichtert sind, dass der Spuk vorbei ist. ”
Auf das Gespräch folgen schlimme Wochen. Uli schaut mir nicht mehr in die Augen, sondern immer ein bisschen an mir vorbei. Er redet nur noch das Nötigste mit mir, manchmal den ganzen Tag kein Wort. Oft werde ich von ihm in Emails nicht mehr ins CC gesetzt – jedes Mal aus Versehen natürlich, wie er beteuert. Ich merke: Uli hasst mich zutiefst. Aber solange er nichts sagt oder macht, bin ich machtlos. Immerhin: die Mittagessen mit ihm sind vorbei. Und es kommt kein einziger sexistischer Kommentar mehr.
SEPTEMBER: Kollegen sagen mir immer wieder, dass sie es so toll finden, dass ich was gesagt habe. Das freut mich. Noch mehr hätte ich mich allerdings über ihre Unterstützung in den Monaten davor gefreut.
OKTOBER: Wir tun alle so, als ob nie etwas gewesen wäre. Mir ist das recht. Ich will weder darüber nachdenken, noch darüber reden.
NOVEMBER: Uli und ich müssen gemeinsam auf Dienstreise. Soweit, so ereignislos. Am letzten Tag essen wir gemeinsam zu Abend. Es ist sogar ganz nett. Nein, ich bin nicht mehr wütend. Zu anstrengend ist das auf Dauer. Verzeihen kann ich ihm allerdings nicht. Und ich vermute, er mir auch nicht.
Und tatsächlich: ein paar Wochen später wechselt Uli überraschend in ein anderes Team, in eine deutlich schlechtere Position. Irgendwie sieht das ziemlich nach einer Flucht aus. Mir wird daraufhin sein Job angeboten. Ein Kollege klopft mir anerkennend auf die Schulter und grinst: „Sieht so aus, als hättest du gewonnen!“
Komischerweise fühlt es sich aber nicht so an.
Ich habe sehr lange überlegt, ob und wie ich von diesem Erlebnis erzählen soll. Ich wünschte, ich hätte einen inspirierenden Text schreiben können, eine Superheldinnengeschichte vom erfolgreichen Kampf gegen das Patriarchat am Arbeitsplatz. Aber so lief es leider nicht. Viel hat damit zu tun, dass ich nicht die feministische Superheldin war, die ich gerne in dieser Situation gewesen wäre. Bis heute schäme ich mich, dass ich erst so spät etwas gesagt habe, bin entsetzt, dass ich mich aus Feigheit, Harmoniesucht und unnötigem Mitgefühl körperlich und seelisch so fertig machen lassen habe. Trotzdem bin froh, dass ich es am Ende durchgezogen habe. Nichtstun wäre schlimmer gewesen, denn dann hätte sich nichts geändert. Ich habe vielleicht nicht gewonnen, aber verloren habe ich auch nicht.