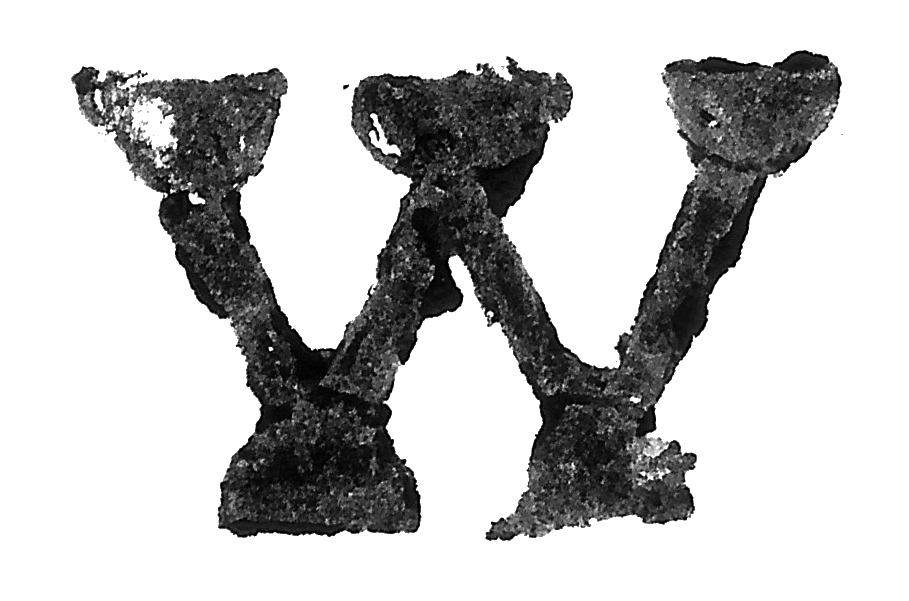Sexismus an Hochschulen, Teil 2: Interview mit Lena Vöcklinghaus
In der aktuellen Diskussion um Sexismus an deutschsprachigen Hochschulen arbeitet Lena Vöcklinghaus zusammen mit der Autorin Alina Herbing als Schnittstelle zwischen den Schreibenden und dem Merkur. Gemeinsam mit dem Merkur lektorieren sie die Texte, planen ihr Erscheinen und ermuntern Stimmen, die sie wichtig finden, zu Beiträgen.
Trotz dieser Mammutaufgabe hat sich Lena die Zeit genommen, für Wepsert meine bohrenden Fragen zu beantworten – herzlichen Dank dafür! Hier geht’s los (die fettgestellten Betonungen sind von mir):
Wie fühlt sich für dich als „Interne“ und direkt Beteiligte die Entwicklung dieser Diskussion an? Wie erlebst du die Verknüpfung der Gespräche, die online in Artikeln und auf Facebook passieren, mit den offline Diskussionen, die in Hildesheim stattfinden?
Ich selbst studiere seit 2015 nicht mehr in Hildesheim und weiß daher nur vom Hörensagen, wie die Diskussionen dort verlaufen. Nächstes Semester habe ich dort aber einen halben Lehrauftrag inne und bin schon sehr gespannt, ob sich das Klima in der Schreibschule gewandelt haben wird, sowohl unter den Lehrenden als auch unter den Studierenden. Insgesamt bin ich aber sehr froh und glücklich über die verhältnismäßig große Resonanz auf das Merkur-Dossier – solche Projekte können ja auch dezent totgeschwiegen werden. Statt dessen erreichen uns aber immer noch Texte, gibt es immer noch Bedarf, weiter zu reden, den bisher gezeichneten Erfahrungswelten weitere Aspekte hinzuzufügen. Diesen Redebedarf gibt es sowohl online als auch offline – oft steckt hinter einem schlichten Like auf Facebook dann doch ein ganzer Berg an Gedanken, die beim nächsten zufälligen Aufeinandertreffen zu einem guten und nahen Gespräch führen. Das erlebe ich gerade als extrem bereichernd, und dadurch, dass ich genau diese Gespräche in meiner Hildesheimer Zeit so sehr vermisst habe, tatsächlich auch als eine Art nachträglicher Reparatur. Ganz pathetisch könnte man sagen, dass ich seit der Debatte den Menschen aus dem Literaturbetrieb insgesamt offener und wohlgesonnener begegne – was in einem absurden Gegensatz dazu steht, wöchentlich mehrere Texte über die zum Teil ja wirklich traurigen Zustände zu lesen.
Gleichzeitig finde ich als „Insiderin“ alles wahnsinnig spannend, weil sich hier das erste Mal in meiner beruflichen Laufbahn Herausgeberinnentätigkeit mit so etwas wie politischem Kalkül oder einer Agenda mischt, und dann eben doch tausend Sachen passieren, die nicht kontollierbar sind. Wer wo wie zitiert wird, wann sich die Medien einschalten und was sie als berichtenswert herausgreifen, welche Rolle der Merkur als traditionsbehaftete und debattenprägende Plattform spielt und welche Alina Herbing und ich dann als lektorierende Instanzen, ist eigentlich nochmal einen eigenen Essay wert, weil sich hier vieles, was wir abstrakt kritisieren, auch wieder konkret zeigt.
Wenn sich alles etwas mehr beruhigt hat, schreibe ich den vielleicht noch. Jetzt gerade finde ich die Inhalte der Texte noch wichtiger, und verfolge ein wenig frustriert, wie sich der Fokus in den Diskussionen in den sozialen Netzwerken immer weiter weg von der eigentlichen Sache – dem Sexismus in Hochschullehre und Literaturbetrieb – hin zu den Formen der Kritik verschiebt. Die Frage, wie Debatten sich gestalten (oder die Frage, ob ein Text „gut geschrieben ist“) kann ja auch eine geschickte Umgehung sein, sich mit den Inhalten der Debatte selbst zu beschäftigen.
Als Schreibende außerhalb von Schreibschulen habe ich dieses Jahr zum ersten Mal und somit völlig naiv das PROSANOVA Literaturfestival besucht, und war verzaubert von dem dort sehr präsenten „Außenseiter“-Blickwinkel, von der stärkenden Stimmung und von den dort gesetzten Themen. Inwieweit hat das Festival dazu beigetragen, nun offen über die Themen der Sexismus-Debatte sprechen zu können? Und inwieweit kann uns eine solche gelungene Veranstaltung Wege aufzeigen, die wir auch in Zukunft gehen können?
Ganz konkret hat PROSANOVA dazu beigetragen, weil auf dem Festival die Idee zum Dossier entstanden ist – hier hat das Festival also seine Funktion als Vernetzungs- und Austauschplattform voll und ganz erfüllt. Warum das Dossier ausgerechnet jetzt diese Anziehung ausübt, verstehe ich allerdings selbst auch noch nicht so recht – die Kritik, die in den Merkur-Texten geäußert wird, gibt es ja schon seit Jahren, in Leipzig zum Beispiel in Form der Zeitschrift PS: Politisch Schreiben, in deren erster Ausgabe bereits ein Essay erschienen ist, der sehr umfassend auf die mangelnde Diversität der Schreibschul-Lehre aufmerksam macht, oder genereller in der Arbeit der Bücherfrauen und der Autorinnen auf 10 nach 8. Und die Autoren und Autorinnen des Dossiers sind auch nicht alle Gäste des Festivals gewesen. Es muss wohl eher so gewesen sein, dass das Gesprächsangebot, das der Merkur in der Form der offenen Beteiligung stellt, auf eine Schreiberinnenschaft getroffen ist, die sich seit Jahren um diese Themen Gedanken macht und diese Form des Austauschs zu diesem Zeitpunkt als für sich sinnvoll erachtet.
Und zu deiner zweiten Teilfrage: Was ich unter anderem richtig toll fand an PROSANOVA, war, dass der Wettbewerbscharakter so runtergeschraubt war. Am offensichtlichsten war dies darin, dass der PROSANOVA-Wettbewerb abgeschafft und durch ein Artist in Residence-Programm ersetzt wurde, das acht Autoren und Autorinnen auswählte und präsentierte, ohne einen Sieger oder eine Siegerin zu küren. Aber den Kampf um die Sichtbarkeit kann ja selbst solch eine Entscheidung nicht auflösen. Die ganze kapitalistische Knappheitsgeschichte bricht mir auch in meinen Spinnereien immer wieder das Genick. Vielleicht erlebe ich deshalb das Merkur-Dossier als eine solche Utopie, weil diese „jede und jeder kann mitmachen“-Haltung und der unendliche Platz des Blogs eine Illusion von Überfluss verschafft. Die ja aber leider auch nur Illusion ist, weil real Redaktionsmitglieder, Schreibende und Lesende Teile ihrer sonst monetär vergütbaren Zeit abzwacken müssen. Wege lassen sich also eigentlich nur dann wirklich aufzeigen, wenn man die kapitalistischen Strukturen mitbedenkt und mitaufzulösen versucht (und das wäre nun wieder so einige Essays wert).
Wo finden die Diskussionen und Dossiers derer statt, die zwar auch strukturell untergraben werden, die aber nicht eine solche schreibschulisch ausgebildete Reflektionsfähigkeit und Wortmacht besitzen? Können wir ihnen durch diese Diskussionen helfen, sie mit-stärken?
Puh. Ich weiß nicht, ob ich nicht viel zu sehr in meiner eigenen Blase verhaftet bin, um diese Frage auch nur annähernd beantworten zu können. Am liebsten würde ich natürlich „Ja, klar“ sagen. Aber wenn ich an den Großteil meiner Verwandschaft denke, der nicht studiert hat, bin ich mir sicher, dass ihm herzlich egal ist, worüber wir hier diskutieren. Andere Professionen haben ganz andere sexistische Strukturen und anderen Debattenkulturen, in denen ich mich nicht auskenne. Wenn jemand mal was von uns liest und sich „mit-stärken“ kann: toll. Sonst tröste ich mich mit dem Gedanken, dass ein diverser Kulturbetrieb mit einer höheren Chancengerechtigkeit dann aber doch auch viel verändern kann, und sei es durch die Erschaffung neuer Fiktionen und neuer medialer Darstellungen, die ihre Wege dann hoffentlich doch irgendwie in die Wohnzimmer finden.
Gleichzeitig möchte ich bei dem Stichwort „strukturell untergraben“ dann aber doch auch nochmal vor meinem eigenen Gartenzaun schauen. Ich denke nämlich gerade viel darüber nach, dass die meisten der Texte, die wir veröffentlichen, so etwas wie „recovery-Geschichten“ sind, also Geschichten von Menschen, die trotz sexistischer Erfahrungen auf sehr guten Wegen sind. Was toll ist, natürlich, gut und wichtig und empowernd. Was aber auch heißt, das bereits im Dossier ungeschriebene Regeln des Sagbaren gelten, und diese Regeln anscheinend, leider, auch über Erfolg definiert sind.
Mich hat das alles [das Konkurrenzgebare meiner Mitstudierenden, die Affäre mit meinem Prof, die befremdeten Reaktionen auf meine Texte, you name it] so abgefuckt, dass ich nach der Schreibschule nie wieder etwas anderes als Gebrauchstexte schrieb, ich wache seitdem täglich mit einem Kloß im Bauch auf und kann keine Zeitung mehr aufschlagen, weil mich die Nachrichten von Debüts meiner Kommilitonen so fertigmachen, dass ich mich tagelang in Selbstmordfantasien flüchten muss: diese Geschichte erzählt bis jetzt noch niemand. Weil Scheitern eben mit Scham behaftet ist, weil die Narration vom Scheitern ohne das Aufstehen am Schluss schwer auszuhalten, geschweigedenn öffentlich preiszugeben ist; und weil zudem im Scheitern die Mischung zwischen Selbst und Struktur so viel schwieriger aufzudröseln ist. Schlimm finde ich, dass in die öffentlichen Nichtexistenz dieser Geschichten sicher auch dieses beschissene sexistische Feminismus-Totschlagargument mit reinspielt: „Die beschwert sich ja nur, weil sie keinen Erfolg hat.“
Vielleicht gibt es also vorerst nur die Fiktion, um solche Geschichten zu schreiben. Als ich in dieser Phase war, hat mir „Die gleißende Welt“ von Siri Hustvedt, in der eine Künstlerin an sich und der Welt scheitert, also: wirklich scheitert, sehr geholfen. Und: ich hätte mich in dieser Phase wohl auch – leider – nicht am Dossier beteiligt. Es bleiben also auch in unserem Dossier viele Dinge ungesagt (und sicher nicht nur in diese, sondern auch in die Gegenrichtung – mit weniger erlebtem Sexismus). Ich wünschte, wir könnten das noch ändern.
☞ Weiterlesen
Lena Vöcklinghaus verlinkt in ihrem Facebook-Profil und auf Twitter regelmäßig die aktuellsten Beiträge rund um die gesamte Diskussion – das gibt einiges an Stoff zum Weiterlesen!