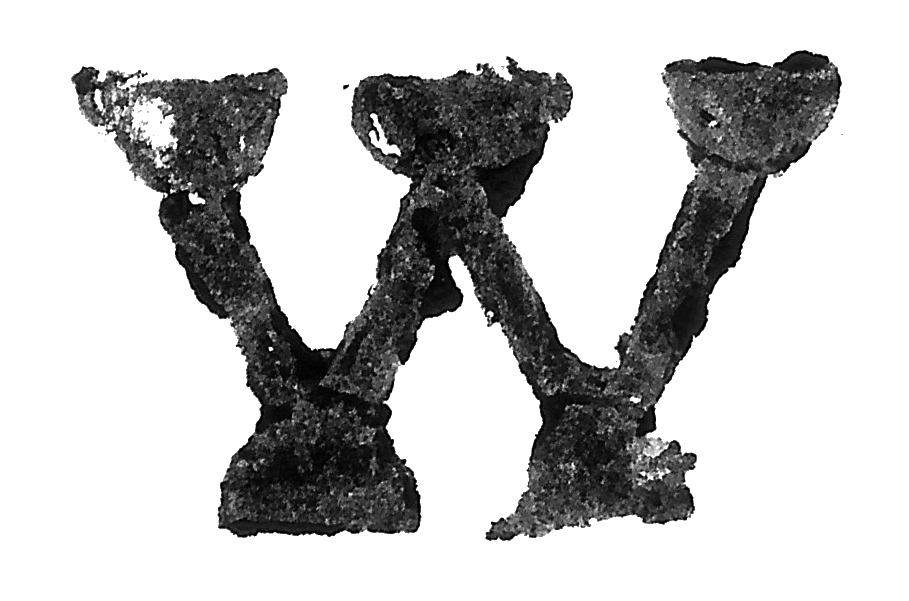WARUM WIR NOCH HIER SIND - Ein Interview mit Autorin Marlen Pelny
Das Interview mit Marlen führte Sara - die beiden sind privat befreundet, was ggf. an der ein oder anderen Stelle deutlich wird.
Marlen Pelny bei der Premiere ihres letzten Romans im September 2023 im Berliner Brechthaus ©Mike Auerbach
Liebe Marlen, wenn man dich im Netz nachschlägt, stößt mensch immer wieder auf die Beschreibung, dass du Städte mit Gedichten “plakatiert” hast: Spiegelt sich darin dein Verhältnis zu Städten wider? Sind diese nur erträglich, wenn du ihnen Worte entgegenstellst?
Nun ja, dass man diese Infos findet liegt, denke ich, als allererstes daran, dass die augenpost - wie dieses Gedicht-Plakat-Projekt hieß – damals viel mediale Aufmerksamkeit erzeugte. Mit der augenpost ist es ein bisschen wie mit dem Hit einer Musikerin. Egal, was die Musikerin im weiteren Verlauf ihrer Karriere noch so macht – sie wird immer mit dem alten Hit in Verbindung gebracht.
Nichtsdestotrotz: Auch wenn ich heute keine Gedichte mehr plakatiere, ist die Stadt, beziehungsweise die Frage danach, wie man mit ihr klarkommt, schon ein großes Thema für mich. Das liegt vermutlich daran, wo ich aufgewachsen bin: In einem sozialistischen Vorzeigeprojekt, einem großen Plattenbaugebiet im Süden von Halle/Saale. Angrenzend Felder, Kiesgruben und Dörfer. Es gab also von Anfang an in meinem Leben den Kontrast zwischen Stadt und Land. Und schon als Kind habe ich mich in der Natur deutlich wohler gefühlt. Allerdings habe ich irgendwann erkannt, dass ein Umzug aufs Dorf für mich sicherlich auch keine Lösung wäre. Die Probleme, die ich mit der Stadt habe, habe ich eigentlich mit der Gesellschaft. Ich hätte sie also überall – ganz egal, in welchen hintersten Winkel ich mich verziehen würde.
Deiner Protagonistin in WARUM WIR NOCH HIER SIND scheint es jedenfalls so zu gehen, dass sie es kaum in Berlin aushält und zunehmend über einen Rückzug aufs Land gemeinsam mit ihrer Freundin nachdenkt – wie geht es dir damit?
Als ich nach Berlin kam, war es die einzige Stadt, die ich mir zum Leben für mich vorstellen konnte. Sie war groß genug, um von der Anonymität zu profitieren, die ich mir in der Kleinstadt so gewünscht hatte. Sie war offen für Menschen jeglicher Herkunft, sexueller Orientierung und jeglichen Aussehens und vor allem habe ich mich in Berlin sehr viel sicherer gefühlt als in der Kleinstadt, nachts allein an einer Bushaltestelle, neben mir nur eine weitere Person, die meistens irgendwie gruselig war. In Berlin trieb ich immer mit, im Menschenstrom. Die Anzahl der Leute, die auf der Straße unterwegs war, nahm ich immer als eine Art Schutz wahr. Egal, ob tags oder nachts. Mittlerweile ist die Atmosphäre anders. Die Anzahl der Leute hat sich vervielfacht. Das sorgt nun eher dafür, dass sich die Stimmung ins Negative dreht. Man ist gestresst voneinander und ich habe auch hier so viele Erfahrungen mit gruseligen Menschen gemacht, dass ich keinen Vorteil mehr erkennen kann. Aber ich bin total verankert in Berlin. Durch meine Freundinnen und Freunde, meine Nachbarschaft, meine Arbeit. Und auch jetzt wüsste ich tatsächlich nicht, wohin sonst, wenn nicht nach Berlin.
“Meiner Meinung nach sollte in jeder Familie ein äußerer Anker installiert werden, der diese Konstellationen entzerrt und dafür sorgt, dass die Kinder verschiedene Lebensentwürfe kennenlernen können. ”
Nach dem Lesen von LIEBE/LIEBE und WARUM WIR NOCH HIER SIND frage ich mich, ob für dich in den Familienfiguren, die keine Eltern sind, insbesondere Tanten und Großmütter, ein radikales, feministisches Potential liegt? Sind diese in deinen Augen sowas wie eine Geheimwaffe?
Ich habe das Gefühl, dass nur wenige Menschen gut funktionierende und glückliche Herkunftsfamilie haben. Und an dem Konzept „(Klein)familie“ zweifle ja nicht nur ich seit Jahren, sondern auch namenhafte Soziolog*innen. Manchmal denke ich, es kann gar nicht gut gehen, wenn Kinder und Eltern so dicht aufeinanderhängen, mit all ihren Macken und Traumata. Meiner Meinung nach sollte in jeder Familie ein äußerer Anker installiert werden, der diese Konstellationen entzerrt und dafür sorgt, dass die Kinder verschiedene Lebensentwürfe kennenlernen können. Damit kann man auch der Überforderung entgegentreten, die oft eintritt, wenn nur zwei – häufig insgeheim ja eher nur ein Mensch, nämlich die Mutter – mit einem Kind zusammenlebt und jeden Tag dafür verantwortlich ist, dass es satt wird, pünktlich aus der Kita abgeholt wird und noch irgendwas am Tag erlebt.
Ich will mit den Wahlfamilien in meinen Texten einerseits die Realität abbilden, die viele Menschen bereits leben und damit das auf magische Weise immer noch vorherrschende Gesellschaftsbild der Normfamilie hinterfragen. Andererseits hat es sich in beiden Büchern angeboten, einen Weg aufzuzeigen, der es möglich macht, das eigene Glück zu finden.
In LIEBE/LIEBE war der Großvater die rettende Instanz. Ich denke auch nicht, dass es zwangsläufig weibliche Menschen sein müssen, die so eine Geheimwaffe symbolisieren können. Denn meiner Meinung nach gibt es genauso viele unfeministische Frauen wie feministische Männer.
Deine Protagonistin liest ARBEIT UND STRUKTUR von Wolfgang Herrndorf – inwiefern ist dir diese Metaebene wichtig gewesen und wieso ausgerechnet dieses Buch?
Es war für mich aus vielen Gründen zwingend, dass die Erzählerin dieses Buch liest. Einerseits wegen des Titels. Meine Erzählerin ist ja auch die ganze Zeit mit Arbeit und Struktur beschäftigt, nachdem ein unbegreifliches Verbrechen passiert ist und der Schmerz um den Verlust des Kindes eigentlich nicht aushaltbar ist. Aber sie geht weiter arbeiten und schafft eine Struktur im Leben der Hinterbliebenen. Zweitens wirkt das Buch, wie ich es in der Szene auch beschrieben habe, wie ein Magnet auf sie. Sie kann nicht sagen, ob es ihr guttut, es in dieser Zeit zu lesen, gleichzeitig kann sie es aber auch nicht weglegen. Sie ist vom Thema Tod umgeben. Und es scheint so, als hätte sie darauf gar keinen Einfluss.
Drittens ging es mir um die Gesellschaftskritik, die in beiden Büchern steckt. Dem einen wird nicht geholfen, die richtigen Medikamente zu bekommen und auch nicht dabei, zu sterben. In meinem Buch wird der Mutter nicht geholfen, zu trauern. Sie wird überhäuft mit Bürokratie und erfährt eine Menge Empathielosigkeit.
Und zuletzt ging es mir auch um die Frage, die in beiden Titeln steckt: Was hält uns hier (noch), wenn etwas so Unbegreifliches passiert ist/passieren wird? Auch Wolfgang Herrndorf half, neben dem Schreiben, sein Freundeskreis. Dennoch bleibt man mit seinem Schmerz allein und es drehen sich immer gleichen Fragen im Kopf: Wie verbringe ich meine Zeit, bis der Tod mich holt? Ist das Leben, das mir zur Verfügung steht (noch) lebenswert?
Ich lese die Frauenfiguren, insbesondere die Ich-Erzählerin, deren Großmutter sowie die Mutter des getöteten Mädchens Heide als (post-)ost-sozialisierte Frauen: Interpretiere ich das rein oder ist das tatsächlich der – auch dein eigener – Hintergrund, der sich durchaus so lesen lässt und insofern eine Entscheidung, der Debatte um Diversität auch einem oft ausgeblendete Ost-Perspektive hinzuzufügen?
Es freut mich, dass du das herausgelesen hast. Durch manche Verweise wie den, dass die Erzählerin aus Halle kommt, wo die Großmutter auch noch lebt – und das in einem Hochhaus – habe ich die ostdeutsche Herkunft ja recht präsent platziert. Wobei sicherlich die Menschen der nachfolgenden Generationen das vielleicht gar nicht wahrnehmen würden. Woran es liegt, dass du diese Herkunft auch in den Figuren erkannt hast, kann ich nicht erklären. Das ist für mich Zauberei. Ich wäre sehr interessiert an einer literaturwissenschaftlichen Erklärung dafür :)
“Mein Roman ist, was die Abbildung von männlicher Gewalt und Männlichkeitsbildern betrifft, in meinen Augen keine Überspitzung.”
Hihi, das klären wir mal bei ner literaturwissenschaftlichen Limo!
In all der Trauer und dem Entsetzen rund um den Femizid an der Tochter der Freundin der Protagonistin leben deine Frauenfiguren doch eine Art Freund*innen-/Frauen*-Utopie, die geprägt ist von Empathie, sich-(aus-)Halten, Zugewandtheit… Brauchen wir überhaupt (cis-)Männer? In deinem Roman bringen sie eigentlich nur Gewalt oder tauchen am Rande auf…
…so wie es in der Realität ja leider auch zuhauf der Fall ist. Mein Roman ist, was die Abbildung von männlicher Gewalt und Männlichkeitsbildern betrifft, in meinen Augen keine Überspitzung. Ich habe hingesehen und aufgeschrieben, was für jede und jeden hier genauso sichtbar sein kann, wenn sie nicht ausblenden oder wegsehen. Man kann diesen Roman als eine Art Demonstration betrachten. Als eine Abbildung des und einen Aufschrei gegen das vorherrschende Patriarchat.
Mir war es wichtig, dem Täter keinen Platz in diesem Text einzuräumen, Männern überhaupt. Ich brauchte sie für diese Geschichte nicht. Und klar, manchmal wünschte ich, die Fiktion schriebe die Realität. Es gibt so viele schöne Geschichten, die ohne (cis-)Männer sehr lebenswert wirken.
Wie kam es zu deiner Entscheidung aus Sicht der Freundin und nicht eines betroffenen Elternteils zu erzählen?
Ich hätte nicht gewusst, was ein betroffener Elternteil hätte erzählen können. Er wäre sicherlich genauso auf der Suche nach Worten gewesen wie meine Erzählerin. Wahrscheinlich wäre es ein Kammerstück geworden. Weil in meiner Vorstellung eine Mutter, deren Kind ermordet wurde, monatelang das Haus nicht verlässt und nichts anderes als Verzweiflung empfindet. Ich selbst hätte Schwierigkeiten gehabt, das zu schreiben und ich denke, Leser*innen hätten Schwierigkeiten gehabt, das zu lesen.
“Meine Texte gehen mir selbst ziemlich an die Nieren und manchmal wünschte ich, ich könnte meine Lebenszeit mit lustigeren Themen verbringen.”
Schreibst du insgeheim an einer „Gewaltformen gegen Frauen/FLINTA*“-Trilogie? Dein erster Roman behandelt sexualisierte Gewalt an einem Mädchen; jetzt ein Roman zu Femizid…
Ehrlich gesagt: Ich weiß nicht, was mein Plan ist. Und ob es überhaupt einen gibt. Meine Texte gehen mir selbst ziemlich an die Nieren und manchmal wünschte ich, ich könnte meine Lebenszeit mit lustigeren Themen verbringen. Aber vielleicht sind diese Themen einfach nicht für mich gemacht. Beim Schreiben braucht man ja schon ein gewisses Durchhaltevermögen. Und Themen, an denen ich mich festbeißen, die ich lange verfolgen kann, sind eben solche. Mal schauen – vielleicht wird es auch eine Tetralogie oder gar eine Dekalogie…
Die Band Zuckerklub in Personalunion: Marlen Pelny und Chio Schuhmacher ©Mike Auerbach
Du bist ja nicht nur Autorin sondern auch Musikerin und Teil der Band Zuckerklub: Welche Anteile lebst du in der Autorinnenschaft, welche eher in der Musik? Gibt es einen Soundtrack, den man beim Lesen deiner Texte, hören sollte?
Ich hatte sowohl mit LIEBE/LIEBE als auch mit WARUM WIR NOCH HIER SIND Lesungen, die wir mit Zuckerklub musikalisch umrahmt haben. Dabei fiel mir auf, wie sehr die Songs und meine Bücher ineinandergreifen. Man bedient sich zwar verschiedener Formen der Genres. Der Mensch, aus dem sie kommen, ist und bleibt aber ein und derselbe. Bis zu diesen Lesungen war mir selbst nicht so klar, dass im Grunde viele Zuckerklub-Songs gewissermaßen ein selbst geschriebener Soundtrack zu meinen Romanen sind.
Aber, da auch unabhängig von meiner Band, Musik sowohl in meinem Leben, als auch in meinen Texten eine Rolle spielt, habe ich auch für Warum wir noch hier sind eine Playlist erstellt. Darin befinden sich Songs, die im Buch vorkommen und Songs, die ich in der Zeit, in der ich das Buch schrieb, gehört habe.
Die Playlist findet sich hier.
Wie geht es für dich jetzt weiter?
Weiter geht’s. Immer weiter. Ich schreibe. Ich schreibe immer weiter.
Danke für das Interview!
Bei der Klopstock-Förderpreisverleihung ©Mike Auerbach