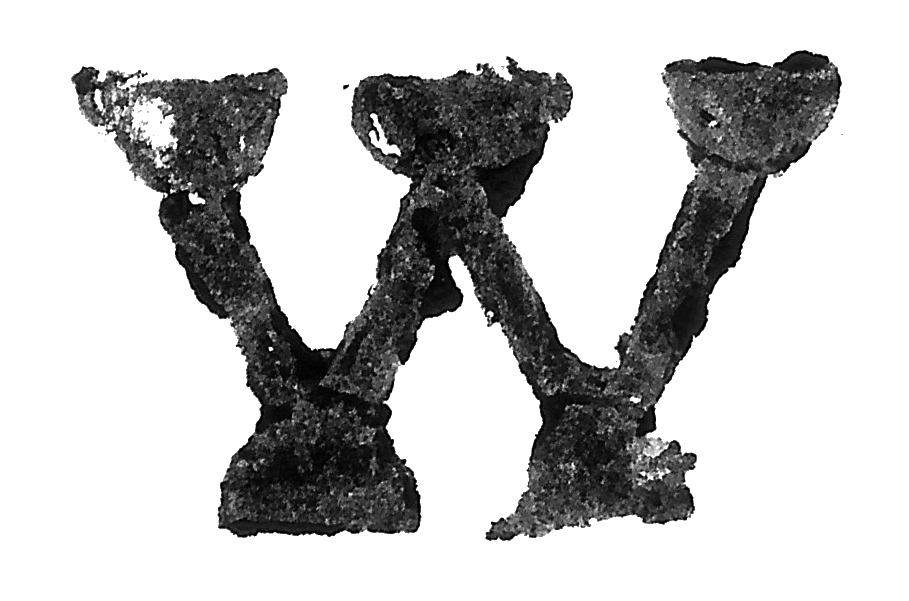Auf den zweiten Blick sichtbar: Ein Gespräch über Klassismus, Geld und die Habitus-Bände mit Paula Fürstenberg
Cover des Bandes „check your habitus“.
Ursprünglich als Online-Format begonnen, ist aus dem Projekt „check your habitus“ ein beachtenswerter, dichter und feiner Sammelband entstanden.
Zu dessen Hintergrund und dem mittlerweile zweiten Projekt in Folge, „Soll & Habitus“, sprach Sara Gómez mit Paula Fürstenberg.
Sara: Hallo Paula, du stehst als Herausgeberin und insbesondere fürs Lektorat bei “check your habitus” – wie ist deine Rolle bei dem Projekt gewesen, ab wann bist du mit in den Prozess eingestiegen?
Paula: Daniela Dröscher [die andere Herausgeberin und Kuratorin] hat sich im Lockdown 2020, als alle Veranstaltungen ausgefallen sind, gefragt, was man jetzt machen kann, und die Idee zu diesem Online-Format entwickelt. Danach hat sie eine Projektleiterin gesucht und dann hat es sich so ergeben, dass wir das gemeinsam konkretisiert und weiterentwickelt haben. Seitdem machen wir eigentlich alle Schritte zusammen.
Sara: Das klingt fast so, als würde das Projekt noch weitergehen?
Paula: Ja, die zweite Runde des Projekts heißt „Soll & Habitus“ und rückt das Thema Geld ins Zentrum. Eine der Beobachtungen aus dem ersten Projekt war, dass wir über Klassengesellschaft und Bildungsaufstieg sprechen und das Thema Geld dabei kaum vorkommt. Da haben wir uns gefragt, was das für ein blinder Fleck ist und was für eine Scheu – die wir, glaube ich, alle von uns selbst kennen –, konkret über Geld zu sprechen. Die Texte gingen im Oktober online und es gibt auch wieder ein Heft bei SuKultur.
“Durch alle Texte zieht sich eine große Skepsis gegenüber dem Aufstiegsnarrativ”
Sara: Den Band habe ich noch nicht gelesen, aber die – wunderschön gemachte! – Website: was ist dein Eindruck, wie dieser zweite Band ankommt?
Paula: Mir scheint, dass es dringend nötig war und ist, über Geld zu sprechen. Viele haben ausgehend von unseren Beiträgen auf Social Media selbst angefangen, über ihr Verhältnis zu Geld zu posten. Auffällig ist, dass wenig konkrete Zahlen fallen. Das liegt wahrscheinlich einerseits an der gesamtgesellschaftlichen Schamhaftigkeit und andererseits daran, dass eine Summe ohne Kontextualisierung wenig Aussagekraft hat. Denn was viel und was wenig ist, hängt davon ab, in welchem Land und in welcher Stadt man lebt, ob man Kinder hat oder jemanden pflegt, etc.
Sara: Nochmal zu dem ersten Band: was sind so für dich persönlich die Aha-Momente gewesen, was hat dich selbst am meisten überrascht oder bewegt?
Paula: Das Eine hat sich schon abgezeichnet, als die Texte nach und nach eingetrudelt sind. Ich hatte vorher darüber nachgedacht, was für eine Perspektive auf die Klassengesellschaft das wohl wird und hatte die naheliegende Vermutung, dass „Erfolgsgeschichten“ erzählt werden würden, weil wir ja Menschen zu Wort kommen lassen, die es in dieser Welt voll gläserner Decken geschafft haben, durch die ein oder andere Decke durchzubrechen. Aber obwohl die Erzählung des Aufstiegsnarrativs – jede*r kann es schaffen – bei einem rein biografischen Blick hier geglückt zu sein scheint, zieht sich durch alle Texte eine große Skepsis gegenüber dem Aufstiegsnarrativ; sie sind geprägt von Umverteilungsphantasien, Wut und Schamgefühlen. Das hat natürlich auch mit dem Kunstmilieu und dem Gefälle zwischen kulturellem und ökonomischem Kapital zu tun.
Das Zweite hat sich im Lektoratsprozess ergeben, als ich gemerkt habe, was für ein sensibler Habitus-Punkt die Sprache ist. Für Autor*innen ist sprachliche Arbeit ja täglich Lohn und Brot. Für Aufsteiger*innen ist die Sprache gleichzeitig eine Stelle, an der sich der Milieuwechsel vollzieht, hörbar und lesbar wird. Für einige der Autor*innen ist Deutsch auch nicht die Muttersprache. Im Lektorat hat sich die Frage gestellt, wie wir mit sprachlichen Verunsicherungen oder auch Dialektalem umgehen – also Dingen, die sonst gern weglektoriert werden. Darüber habe ich viel mit den Autor*innen gesprochen und meistens haben wir entschieden, so viel wie möglich davon zu erhalten, weil das auch den hochkulturellen Habitus sichtbar macht, wie der Literaturbetrieb ihn gerne pflegt.
Sara: Und dann nehme ich an, dass es einen Balance-Akt gab, weil du niemanden ausstellen willst? In dem Moment, wo man diese sprachlichen Unsicherheiten drin lässt, bietet man vielleicht auch eine Angriffsfläche – oder war das kein Thema?
Paula: Ich hatte zu keinem Zeitpunkt die Sorge, jemanden auszustellen oder vorzuführen. Zum Einen sind das ja alles professionelle Autor*innen, die bewusst entschieden haben, was sie für das Projekt preisgeben. Und zum Anderen hatte ich den Eindruck, dass sogar eher das Gegenteil passiert: Durch eine bestimmte Verletzbarkeit und die persönliche Ebene in den Texten entsteht eine große Stärke. Was ich aus Lea Schneiders Essay „Scham“ gelernt habe, ist, dass typisch für die Scham ist, dass sie verschwindet, sobald man sie sich genau ansieht und sie benennt, weil Scham davon lebt, verschwiegen und vertuscht zu werden. Und sobald man diese Vertuschung aufhebt, löst sich auch ein Großteil der Scham auf. Ich glaube, das ist typisch für viele emanzipatorische Prozesse.
Sara: Und als Leserin kann ich das total bestätigen: es hat eine große, verstörende Power dieses Thema, gerade weil es so subtil ist; plötzlich hatte ich den Eindruck: in allen Ritzen sitzt der Klassismus. Und ich hab mich ertappt gefühlt, denn ich weiß gar nicht genau, wo ich mich selbst verorten würde! Auf alle Fälle habe ich viele dieser Kämpfe nicht zu kämpfen gehabt und hatte dann selbst mit einer Scham zu dealen. So wie der Band komponiert oder kuratiert ist, hat er wirklich eine besondere Dichte.
Die Mitherausgeberin und Lektorin der Bände „check your habitus“ und „Soll & Habitus“ Paula Fürstenberg (© Nora Linnemann).
Paula: Das freut mich! Spannend finde ich, dass du meinst, du wüsstest selbst nicht, wo du dich einordnen würdest – mir ging’s ganz ähnlich. Meine Beschäftigung mit dem Thema hat erst im Winter 2019 so richtig begonnen. Daniela kuratiert ja auch die Reihe „Let’s talk about class“ in Berlin im ACUD und hatte mich eingeladen, um über den Zusammenhang von Ostdeutschland und Klassengesellschaft zu sprechen. Und ich saß vor dieser Anfrage und dachte: Worüber willst du sprechen? Die Ostdeutschen als Klasse? Es hat ein, zwei Tage gedauert, bis ich eine Idee hatte, was ich dazu sagen könnte, und dabei kam das erste Mal die Frage auf, welcher Klasse ich eigentlich angehöre. Ich glaube, es ist ein Symptom davon, dass in den letzten Jahren wirklich wenig über Klassengesellschaft gesprochen wurde. Auch wenn ich Freundinnen und Freunde frage, wo sie sich eigentlich verorten, kommt erstmal ein großes Rätseln, welche Klassen es überhaupt gibt. Es gibt überhaupt kein selbstverständliches Sprechen darüber, keine Vokabeln, keine Praxis der Selbsteinordnung. Und ich finde es bemerkenswert, dass es auch im feministischen Kontext, in dem auch wir gerade miteinander sprechen, nicht anders ist. Der intersektionale Feminismus denkt ja race, class und gender schon lange zusammen; Frigga Haug nennt es den Herrschaftsknoten. Trotzdem ist „class“ ein Aspekt, der häufig hinten runterfällt. Ich glaube, angesichts bestimmter aktueller Entwicklungen gibt es eine große politische Notwendigkeit, „class“ stärker in die Debatten reinzuholen.
“Das Arbeitersubjekt des historischen Klassenkampfs ist weiß und männlich – diese Vorstellung gehört aktualisiert und da gehört eine intersektionale Perspektive rein”
Sara: Es wird ja, auch innerhalb der Linken, ein starker Unterschied gemacht zwischen einerseits der sogenannten Identitätspolitik und andererseits dem Klassenkampf. Wie siehst du das und wie ist da eure Haltung auch als Herausgeberinnen?
Paula: Es geht ja viel darum, was davon nun wichtiger ist als das andere. Ich glaube aber, dass Fragen der Identität und des Klassenkampfs nicht gegeneinander ausgespielt gehören. Man kann sowohl die Klassengesellschaft aus intersektionaler Perspektive besprechen als auch einen realpolitischen Klassenkampf führen. Das Arbeitersubjekt des historischen Klassenkampfs ist aber männlich und weiß konzipiert und diese Vorstellung muss aktualisiert werden, um überhaupt einen gemeinsamen Klassenkampf führen zu können. Was wir aus dem literarischen Feld beisteuern können, sind Geschichten und Perspektiven, die an anderer Stelle fehlen.
Sara: Gerade in jüngster Zeit habe ich den Eindruck, dass eben mehr eine Verquickung von Klasse, Rassismus und Sexismus in den Literaturbetrieb rückt, z.B. Deniz Ohdes Roman “Streulicht” – was glaubst du, was ist der Grund, warum das gerade passiert?
Paula: Ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass sich Deutschland zunehmend zu einer Klassengesellschaft entwickelt, in der Unterschiede zwischen Reich und Arm zunehmen und in der die Wohnraumfrage brennt. Wer kann sich was leisten, wer verdient wie viel, wie steigen Einkommen und Renten im Vergleich zu den Mietpreisen, wer kann sich einen ökologischen Lebensstil leisten – das sind so drängende Frage, dass sie sich auf alle anderen Debatten ausweiten. Außerdem glaube ich, es gab die naive Vorstellung, dass sich bestimmte Dinge mit den Generationen erledigen: dass wir ostsozialisierten Kinder in der vereinten Bundesrepublik aufwachsen und sich die DDR als Prägung erledigt. Oder dass die Kinder der sogenannten „Gastarbeiter“ hier aufwachsen und nicht mehr die Fremdheitserfahrungen ihrer Eltern machen. Beides stimmt in Teilen natürlich auch. Aber jetzt gibt es intergenerationell auch die Beobachtung, dass sich die Dinge nicht komplett erledigen, sondern sich fortschreiben und dass die Biografien der Eltern und das Großgewordensein in bestimmten Kontexten massive Auswirkungen haben. Die Dringlichkeit entsteht also vielleicht auch aus der Generationenfolge, weil jetzt die Stimmen nächster Generationen die Debatten um ihre Perspektiven aktualisieren wollen.
Sara: Würdest du sagen, da spitzt sich was zu oder ist es eher der Mut von den Leuten, die vielleicht manche Kämpfe, die ihre Eltern kämpfen mussten, nicht in der Form kämpfen müssen und dafür nun Platz ist oder ist es beides? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen oder wir können gemeinsam raten, was es ist?
Paula: Ich fürchte, es ist ein Raten, weil in Wahrheit immer schleierhaft ist, was warum wann plötzlich Platz im Diskurs haben kann. Aber man muss auch nochmal sagen, von was für einem Platz wir überhaupt reden, denn es ist ja ein „Bubble-Platz“ – wenn man sich die politische Gegenwart ansieht, ist es nicht so, dass Konzepte gegen Verteilungsungerechtigkeit Thema Nummer eins wären.
Es gibt eine große identitätspolitische Bühne im Moment, an der sicher auch vieles zu kritisieren ist, die aber erstmal spürbar die Auswirkung hat, dass etliche Stimmen Platz bekommen, die vorher kaum zu hören waren. Auf Literaturhäuser, Redaktionen und Verlage es ist ein Druck entstanden, ihre Programme zu diversifizieren und einer pluralen Gesellschaft gerecht zu werden. Ich hoffe, dass das nachhaltig ist, und ich hoffe auch, dass diskriminierte Communities nicht für immer nur über ihre Diskriminierungserfahrungen sprechen dürfen. Wir werden sehen, es zeichnet sich noch nicht so richtig ab.
“Ich freue mich, wenn Literatur dazu führt, dass Menschen darüber nachdenken, was das mit ihrem Leben zu tun haben könnte”
Sara: Ihr habt euren ersten Band „check your habitus“ genannt und die Assoziation dabei ist „check your privilege“: Welches sind die Aufforderungen an die Leser*innen, die mit diesem Titel einhergehen?
Paula: Ja, der Titel „check your habitus“ dockt an den Hashtag an. Gleichzeitig ist typisch für Bildungsaufsteiger*innen, dass sie weder nur privilegiert noch nur diskriminiert sind – was ja für fast jeden Menschen auf der Welt gilt. Beim Lesen autobiografischer Erzählungen, die an strukturelle gesamtgesellschaftliche Gegebenheiten andocken, fängt man als Leser*in oft an, seine eigene Geschichte daneben zu legen. Ich glaube, das ist weniger dem Titel geschuldet, sondern vor allem ein Phänomen des Autobiografischen und der damit verbundenen Verbürgtheit von Geschichten. Ich freue mich, wenn Literatur dazu führt, dass Menschen darüber nachdenken, was das mit ihrem Leben zu tun haben könnte.
Sara: Vor allem, wenn es so gut gemacht ist! Es hat eben nichts Exhibitionistisches an sich, es ist kein Tagebuch, es bleibt ja in einer sehr ästhetischen Form, einer Art Schutzhülle, und läuft nicht Gefahr, kleingeredet oder in Einzelschicksale zerlegt zu werden, das finde ich eine totale Stärke!
“Es geht darum, die Verbindungslinie zwischen den Geschichten zu ziehen und sichtbar zu machen, dass Menschen auch in strukturellen Wirklichkeiten leben”
Paula: Ich möchte kurz was zur Schutzhülle sagen, was ich einen sehr schönen Begriff dafür finde. Aber wo kommt die eigentlich her? Ich glaube, sie entsteht vor allem durch die Vielstimmigkeit: Das hätte nicht funktioniert, wenn da nur zwei oder drei schreiben. Im ersten Band sind es 18 Autor*innen, im zweiten 15, die eine Art Chor bilden. Wenn ein Chormitglied spricht, stehen die anderen quasi daneben, und dadurch sind sie geschützt davor, als Einzelschicksal oder Ausnahme abgetan zu werden. Es geht hier nicht darum, ein Einzelschicksal auszustellen, es geht darum, die Verbindungslinie zwischen den Geschichten zu ziehen und sichtbar zu machen, dass Menschen auch in strukturellen Wirklichkeiten leben.
Und die Reaktionen haben uns auch sehr gefreut. Ich mochte vor allem jene, die ausgehend von den Texten angefangen haben, von sich zu erzählen. Auf Instagram hat z.B. Florian Valerius keine Rezension, sondern drei eigene kleine Texte geschrieben und so den Chor erweitert. Oder Florian Kessler, der gepostet hat, der Band habe ihn vom „Sitzsack des Nicht-Wissens“ geholt. Auch diese andere Perspektive – sich nicht zu identifizieren, sondern die Unterschiede zur eigenen Wirklichkeit wahrzunehmen – hat mich sehr gefreut. Das sind die Reaktionen, die ich besonders liebe, bei denen ich spüre, da passiert was im Blick auf die Welt und sich selbst.
“Der Habitus wird spätestens auf den zweiten Blick sichtbar”
Sara: Toll! Und, wie du vorhin schon sagtest, hoffentlich auch nachhaltig! Also, dass das Thema etwas mehr verankert wird; dass Personen dann nicht nur wegen einer bestimmten Diskriminierungsform, die sie erleben, eingeladen werden oder zu Expert*innen von nur e i n e m bestimmten Thema gemacht werden. Ich frage mich, ganz polemisch, ob es bei „Klasse“ leichter ist, weil sie nicht ganz so sichtbar ist? Vielleicht findet sich die Antwort auch in eurem Band. Denn ich fand eben das Krasse, diese Subtilität – eine Person schreibt darin, von dem „Vorwissen“, das sie nie haben wird, daran konnte ich sofort andocken…
Paula: Ich glaube, da hast du einen guten Punkt, also, dass Race und Gender meistens sichtbare Kategorien sind oder zumindest sofortige Zuschreibungen von Außen erzeugen und deshalb erstmal die Kategorien sind, mit denen schon auf den ersten Blick umgegangen werden muss. Wobei natürlich auch in Bezug auf Class sofort Zuschreibungen passieren über Klamotten, Sprache, Gestik – der Habitus wird spätestens auf den zweiten Blick sichtbar.
Ich habe in letzter Zeit mal meine Freundschaften daraufhin abgeklopft, wer eigentlich was für einen familiären Background hat. Zuerst hab ich festgestellt, dass ich es in vielen Fällen gar nicht so genau wusste oder wieder vergessen hatte, weil ich Class als Analysekategorie lange nicht parat hatte. Es steckt ja auch ein großes utopisches, schönes Potential darin, sich nicht dafür zu interessieren, weil es keine Rolle spielen soll. Aber wenn ich mich mal dafür interessiere, dann stelle ich fest, dass es eben doch eine Rolle spielt und wirklich absurd viele meiner engsten Freundinnen und Freunde Aufsteiger*innen sind. Der Habitus entfaltet Wirkung, auch ohne, dass ich mir seiner bewusst bin. Dabei bin ich selbst keine klassische Bildungsaufsteigerin, mein Vater war zwar Schmied, aber ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, die studiert hat. Dass ich an die Position als „transclasse“ persönlich andocken kann, kommt bei mir vor allem aus dem Ost-West-Gefälle.
“Krieg den Palästen // I want your money back”
Cover des Bandes „Soll & Habitus“
Sara: Du hast die Utopie vorhin selbst genannt: gibt es eine Utopie oder mehrere, die du mit euren Bänden verbindest?
Paula: Die Utopie ist natürlich ein intersektionaler Klassenkampf, der an Verteilungsungerechtigkeiten tatsächlich etwas ändert. Der erste Band hört ja auf mit drei Texten unter der Überschrift „Enteignen“ – das war schon eine bewusste Setzung am Schluss. Und im neuen Band gehören zu den letzten Überschriften „I want your money back“ und „Krieg den Palästen“. Ich glaube, da findet sich schon die Richtung, in die wir denken.
Sara: Hast du noch eine Frage, von der du findest, dass sie dir gestellt werden sollte?
Paula: Was mich noch beschäftigt hat, ist, dass das Thema an sich sehr politisch ist und es dann sehr viel um Gefühle geht: Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit, Scham und Wut und das Gefühl hochzustapeln. Diese selbstverständliche Politisierung der Gefühle mochte ich an der Arbeit bei dem Projekt besonders bzw. überhaupt Gefühle als politisch relevanten Gegenstand zu betrachten und ernstzunehmen.
Sara: Das nehme ich als Schlusswort, vielen Dank Paula, und viel Erfolg auch mit dem zweiten Band!