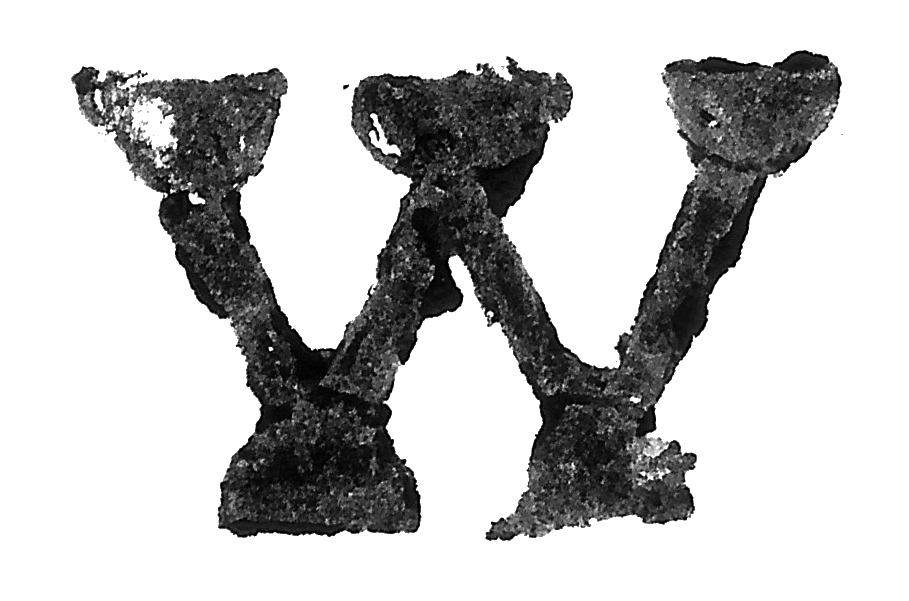„Das blaue und das weiße Federbett“ von Larissa Wallner
Am Morgen bildeten das blaue und das weiße Federbett über unseren angewinkelten Beinen zwei sich berührende Kumuluswolken. Auf ihnen hatten wir unsere MacBook Pros mit den hell leuchtenden Äpfeln auf stahlgrauem Grund abgelegt. Die relative Stille des Zimmers wurde unterstrichen vom leisen Summen des Heizkörpers unter den breiten Fenstern, vom fernen Rauschen der Autos, das von der Humboldtstraße hinauf und vom Nockherberg herüber drang. In der Außenwelt jenseits dieses Zimmers im Hefnerstraßenland rührt sich sonntags kaum etwas außer der Züge, die alle paar Minuten am Rand des Giesinger Bergs tosend, lärmend vorbeidonnern. Diese leisen Geräusche, Summen und Rauschen, mischten sich an jenem Dezembertag mit dem fernen Gemurmel einer Waschmaschine, die in einer der Wohnungen im Haus lief.
Nina hatte die linke Hand sinnierend und gedankenlos an ihr blasses, von einem, in den Lichtverhältnissen dunkel wirkenden Bob eingerahmtes Gesicht gelegt, wo sie von der Wange zum Mund glitt, dort einen Moment ruhen blieb, die Lippen antippte und betastete, die Nasenwurzel mit dem Zeigefinger berührte und dann den Daumen und den kleinen Finger auf die Mundwinkel setzte. Diese Geste war typisch und unbewusst und sagte mir, dass sie las und über das Gelesene nachdachte. Sie trug ein dunkelblaues Schlafanzugoberteil aus dünnem Stretch mit langen Ärmeln. Die Hälfte ihres Gesichts wurde von einer dicken Hornbrille versperrt, die ihr, obwohl sie ihre Augen optisch verkleinerte und einer Biologenschutzbrille glich, gut stand, weil sie ihre Intellektualität, ihre tatsächliche geistige Auseinandersetzung, aber auch ihr Interesse an Mode und Stil physisch repräsentierte, ohne diese Wesenszüge bloß vorzugaukeln. Die Brille war keine jener modischen Pantobrillen, mit der in München seit gut zwei Jahren jeder zweite Junganwalt auf Brautschau seine, auf Status und Prestige begrenzten Interessen mit einer kulturaffinen Patina und zu verschleiern trachtete.
© Bernhard Rappold.
Nachdem sie einmal kräftig den Schleim aus ihrer Nase in ihre Stirnhöhlen hochgezogen hatte, wanderte die schmale, schlaffe Hand wieder zur Wange zurück, berührte diese mit den Fingerkuppen und legte sich dann an die flache Biegung ihres Gesichts unter den Wangenknochen – wie der Fächer eine Palmblatts, das auf einen sonnigen, mediterranen Boden segelt und auf ihm ruhen bleibt.
So saßen wir seit einer Stunde in meinem Bett und waren mit unseren Junge-Frauen-Hintern tief in die dicke Dunlopillo-Matratze gesunken. Ich hatte schon eine Tasse des inzwischen kalten Kaffees getrunken, ihr einen Frühstücksbrei und mir einen Brei aus Haferkleie – in ihren Worten „deinen Kleister“ – gemacht. Die Tontasse von der Auer Dult lehnte an der Wand links von mir, jener Wand, die die schlauchförmige Wohnung zum Hausflur abtrennt, in dem man die Nachbarn vorbeistürmen hört, die Treppen hinauf und hinunter poltern. Dann ist es ein bisschen, wie wenn Fremde durch die Wohnung laufen, eine Wohnung, die schon durch ihren Grundriss einem Schuhkarton gleicht, der zur Straße hin geöffnet ist, wie ein Schaufenster, oder wie eines dieser Miniaturtheater, die ich als Kind aus einer Kiste, in die Gucklöcher geschnitten waren, durch die man alle möglichen Szenerien aus Pappe betrachten konnte, gebastelt habe. Und immer am Ende des Kartons, das gegenüber der Löcher für die Augen lag, klebte ich einen Spiegel, sodass ich stets meine eigenen tiefdunklen, im Karton vergrößerten Augen sehen konnte, wie die einer auf die Miniaturwelt blickenden, gefährlich-riesenhaften Fremden.
Wenn die Nachbarn so akustisch durch die Wohnung zu laufen scheinen, stört mich das immer dann, wenn ich Sex habe, weil ich leise sein muss, mich schämen und mich in meiner Intimität gestört fühle. Und es quält mich immer dann, wenn ich einen Rausch ausschlafe und versuche den Schmerzen, die unausweichlich im Moment des Erwachens über mich hereinbrechen werden, noch einmal eine Stunde zu entgehen, indem ich vor ihnen immer wieder ins Dunkel des Traumes zurücksinke.
An diesem Tag war es still, wo es weder Sex noch Kater gab und das Zimmer war wie eine kleine Welt für sich, die nichts mit dem, was früher gewesen war oder dem, was außen passierte, zu tun hatte. Da saßen wir, Nina und ich, mit angezogenen Beinen, über die wird die Federbetten gewickelt hatten, die Nina „Plümo“ nennt, sie an der Gangseite und ich an der Stirnseite des Bettes, so dass ich durch das Fenster die Häuserfronten gegenüber sehen konnte, einen kahlen Strauch, eine braune Regenrinne, eine graue und eine gelbe Fassade, dunkelbraun lasierte und weiß lackierte Fensterrahmen mit aufgesetzten Streben. Das Zimmer lag im Halbdunkeln, spärlich erhellt durch das graue Licht des Regentages, das auf das Eichenparkett fiel. Die kugelförmige Ikea-Lampe auf einem Stahlstab, ihr glanzloses Milchglas grau vom Staub und den kontinuierlichen Nikotin- und Teerbedampfungen, glomm wie ein blasser Vollmond in dunklem Orange. Aus der Küche tönte in ständiger Wiederkehr das Klicken und anschließendes Knarren der sich an und ausschaltenden Kaffeemaschine, die am Ende des Raumes, am Fenster zum Hof, steht. Ihr Ein- und Ausschaltknopf leuchtet rot in meiner Vorstellung. Ich spürte meine Muskeln, im Bauch, in der Brust, in den Oberschenkeln über den Kniekehlen vom Laufen und den Liegestützen und Sit-ups, die ich auf eben jenem Eichenparkett, Zierde der Wohnung, tags zuvor aufgeführt hatte. Ich halte mich durch Bewegung und Schmerz in meinem Körper, ziehe mich auf den Boden, in die Welt und nur zu langes Laufen, die Isar hinauf und hinunter, und ständiger Muskelkater verleihen mir Schwerkraft und Haftung in diesen Tagen.
© Larissa Wallner
Nina schnäuzte sich zum zweiten Mal, räusperte sich anschließend und zog wieder den Rotz hoch, während sie auf dem Mousepad mit dem Zeigefinger und Daumen der rechten Hand durch ihr Exzerpt der Traumdeutungen von Freud scrollte. Sie hatte sich zwei Nächte zuvor, als wir bis in den Morgen in Jans Wohnung zu den theatralischen Klängen des Disco der Siebziger und Achtziger und zum R´ n B der Neunziger getanzt hatten, auf dem Heimweg erkältet. Gleichzeitig wäre sie nicht krank geworden, wäre vielleicht eines der anderen Ereignisse, die in der Summe zu viel gewesen waren, nicht eingetreten: Da war der Sturz, von dem sie sich einen großen blauen Fleck auf dem Knie zugezogen und einen Schrecken davon getragen, hatte, der ihr wie sie sagte, in die Knochen gefahren war und ihr die eigene emotionale und physische Fragilität vor Augen führte. Dazu kam der viele Alkohol in letzter Zeit, die zahllosen Zigaretten und die durchwachten Nächte. Da war auch die Tatsache, dass sie, wie sie es nannte, vagabundierte, dass sie keine eigene Bleibe hatte, sondern nach der Trennung von ihrem langjährigen Freund nomadenhaft vorübergehend bei Freunden untergekommen war.
Sie sagte, sie fühlte sich seit Wochen wie in einem Taumel, haltlos, rauschhaft, in einem Taumel, in dem alle Empfindungen intensiv und ungefiltert sind, aber in dem sie auch Gefahr läuft zu fallen, und zugleich die ganze Zeit im Grunde schon fällt. Der Sturz war die Reaktion auf eine irritierende Antwort unseres gemeinsamen Freundes Kalle, auf die Frage, ob er denn später noch zu uns stoßen würde: „Das weiß nur der Pimmel“ hatte er mit seinem Nokiahandy geschrieben. Bei ihm konnte das heißen, dass er noch nicht wusste, ob er lieber Sex mit Sarah/Christin haben würde, statt mit uns tanzen zu gehen, oder es konnte eine Anspielung auf den Phallus als den Signifikanten, als Gott-Substitut, bei Lacan sein, oder, und das war das Wahrscheinlichste: Es konnte einfach gar nichts bedeuten, außer einer Weise zu sagen „ich weiß es noch nicht“. Nina, die die Nachricht in einem ungünstigen Moment erreichte, stieß noch im Lesen der Nachricht mit den Fußspitzen gegen den Randstein und stürzte.
Im Hefnerstraßenland begann es zu schneien, in kleinen Flocken, die vom Wind, wie in einer Schraffur zu Linien und Flächen gedrängt wurden, deren Vektoren steil auf den gefrorenen Erdboden wiesen. Sie hatte mir gerade von einem Traum erzählt, während ich gedanklich verschiedene Themen gestreift und über sie hinweg geschweift war. Im Traum sei ihre Schwester gestorben. Nach der ersten Bestürzung sei sie damit aber zurechtgekommen. Wir deuteten den Traum, deuteten ihn bloß an, kamen auf die Fantasien, die Single Girls wie sie in diesen Tagen auch hatten, manche von uns: Familie irgendwann, ein Anderer, jemand, der nicht stirbt, den man nicht verlässt, der nicht verlässt, wie die Eltern, wenn sie sterben – statt der Eltern sollen es die Schwestern.
Ich hatte mich nach dem Körper unserer Kommilitonen gefragt, warum sie alle zart und schlank waren, wenn sie nicht trainierten, warum sie kleine und so feingliedrige Pianisten-Hände hatten. Warum ihre Nasen gerade waren und ihre Haare oft halblang, warum der Blick mancher nach innen gerichtet, verträumt war – für sich selbst zu allererst empfänglich und sensibel, Humanisten, Geisteswissenschaftler, Professorensöhne. Der Blick anderer, ehrgeizigerer war hart und kühl, aggressiv und starr auf die unsichtbaren Objekte im Raum gerichtet, während sie uns etwas erklärten und eine einzige Wendung im Text zum Anlass nahmen, ihr gesamtes Wissen zu präsentieren. „Die Korrespondenztheorie der Wahrheit gegen die Wahrheit im Begriff“– Hegel, Pegel, Penis – das war Lenas Kinderspiel, das sie mit jedem Namen anstellte. Das Anderssein der Anderen, derer, die wirklich den ganzen Heidegger, den ganzen Levinas gelesen hatten, bemerke ich, wenn wir diskutierten und zusammen saßen mit Freunden und Fremden mit krummen Rücken, vornübergebeugt, in der einen Hand ein Glas mit Gin, mit der anderen gestikulierend. Waren wir alle Gleichgesinnte, Freunde oder konkurrierten wir ständig? Wer gehört wirklich dazu? Ich fühlte mich oft dazwischen, Bürgerin mancher Welten, im Absprung begriffen oder schon Anlauf nehmend.
Während Nina duschte, dachte ich an einen anderen Mann, einen Maler aus Wien, der meine Fantasie bewohnte und in meinem Bewusstsein spukte. Er steht so breitbeinig, wie ich es nicht könnte, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Ob er denn weiß, was er tut? Ob er denn weiß, was er spielt? Ob er denn überhaupt weiß, dass er spielt? Seinen Körper stellt er auf wie ein Faktum, das sich nicht umgehen lässt. Er sonnt sich in meinem Blick wie ein Kater, der sich noch dösend auf einem warmen Holzbrett streckt. Vielleicht macht das mein Blick auf ihn, oder sein Bild meines Blickes auf ihn. Ich bin sein Spiegel aber mein Spiegel-Sein ist mein Spiegel für mich. Es ist eine wechselspielende Vervielfältigung visueller Begegnungen: Ich sehe, dass Du siehst, dass ich Dich sehe. Subjekt, Subjekt-Objekt, objektiviert durch das Objekt-Subjekt. Ich verlor mich in den imaginären Variationen der Situation am Bahnhof potenzieller, zukünftiger Eroberung, wenn ich ihn besuchen fahren würde in Wien, was passieren würde, wenn ich aus dem Zug stiege. Ob er da sein würde. Ob ich ihm dann die Hand geben sollte.
Der Schnee wird zu Regen, gefriert und knistert als Hagelkörner ans Fenster.
Nina tanzt in meinem weißen Bademantel, wiegt sich hin und her, eine Tasse schwenkend. Während sie mich frech und offen angrinst, bestaune ich ihre schlanke und zarte, von einer eigentümlichen Anmut geprägte Gestalt, die der Mantel zugleich verhüllt und präsentiert. Ich kann nicht anders, als das zu bemerken. Sie trägt ein weißes Handtuch um den Kopf geschlungen. Weil sie meine Bewunderung nicht ungebrochen lassen kann, dreht sie die Anlage auf und spielt „Sexy“ von Marius Müller-Westernhagen, was mich pikiert, abstößt und belustigt. „Sexy, was hast Du mit diesem Mann gemacht.“ Nina steigt mit einem Fuß in den Slip, zieht ihn hoch unter den Mantel und streckt einen abgespreizten Fuß hinter sich in die Luft. Sie lacht.
Larissa Wallner ist ihrer Ausbildung nach akademische Philosophin und Juristin und promoviert gegenwärtig über die Bedingungen von „Transgress“, der Möglichkeit produktiver Selbstüberschreitung des Denkens in Immanuel Kants kritischer Philosophie. Sie interessiert sich in ihren sich überschneidenden Arbeitsbereichen – Philosophie, Malerei und Literatur – für Kunst als Medium philosophischer Exploration, Autofiktion/Autobiografie und Experiment, aber auch für das weibliche Gegenüber, der Selbstbegegnung im Anderen sowie für Phänomene von Entfremdung und Groteske. 2018 erschien ihr Buch Dimensionen der Zeit. Die Zeitphilosophie Kants und Husserls bei Passagen Wien. Sie lebt mit ihrem Partner, dem Wiener Maler Bernhard Rappold und ihren gemeinsamen Töchtern in Berlin.
☞ Weiterlesen
Zu Larissas Buch im Passagen-Verlag hier.